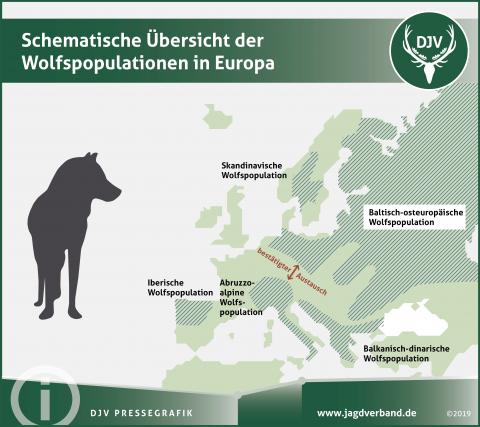Ein US-Amerikanischer Jäger hat kürzlich in Pakistan anlässlich einer kontrollierten Jagd eine seltene Schraubenziege (Markhor) für 100.000 Dollar erlegt. Der Aufschrei in den Medien war groß, Tierrechtler bezeichneten die Erlegung als "Schande". Der Internationale Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) und der Deutsche Jagdverband (DJV) fordern eine sachliche Bewertung der Situation: Die Einnahmen aus der streng reglementierten nachhaltigen Jagd auf die Schraubenziege haben überhaupt erst deren Wiederansiedlung in weiten Teilen des ursprünglichen Verbreitungsgebietes ermöglicht. Lag der Bestand des Markhor Mitte der 1980er-Jahre bedingt durch massive Wilderei noch bei unter 100 Tieren, leben heute dank der Einnahmen aus der Jagd weit über 7.000 Schraubenziegen in Pakistan, so ein IUCN- Spezialist. Diese Entwicklung führte dazu, dass der Markhor in der Roten Liste der IUCN seit 2015 nicht mehr als "bedrohte Art" geführt wird.
Die Einnahmen aus dem Verkauf limitierter Lizenzen fließen direkt in die Schutzgebiete, in denen die Wildziegen vorkommen. Die Abschusslizenzen werden nach sorgfältiger Prüfung durch Artenschutzexperten vergeben. In den Pakistanischen Markhorgebieten ist die Wilderei drastisch zurückgegangen, die Bestände nehmen stetig zu. "Die lizensierte Erlegung von vier Markhoren pro Jahr hat keinerlei Auswirkung auf die Bestandsentwicklung. Die Einnahmen aus den Lizenzen aber dienen der Finanzierung von Wildhütern, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Kompensationszahlungen. Letztere sind wichtig, um die Weidetierhaltung vor Ort zu reduzieren, da Wildziegen als Konkurrenz angesehen werden", sagt Dr. Wilhelm von Trott zu Solz, Leiter des deutschen Delegation des CIC. In einer 2016 von der IUCN herausgegebenen Informationsbroschüre wird die Jagd auf Markhor und Urial, ein ehemals gefährdetes Wildschaf, als positives Fallbeispiel gelistet - positiv für den Artenschutz und den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung einer finanzschwachen Region.
"Die Landstriche, in denen Gäste unter Aufsicht jagen, eignen sich oftmals nicht für andere Formen des Tourismus. Sie sind unerschlossen und kaum zugänglich. Ohne die Einnahmen aus nachhaltiger und gut gemanagter Jagd, müssten sich die Bewohner der Berge Pakistans andere Einkommensquellen erschließen. Das bedeutet zwangsläufig einen Schritt zurück zu mehr Viehhaltung und Wilderei", so DJV-Vizepräsident Dr. Wolfgang Bethe. Durch Jagdlizenzen finanzierte Schutzkonzepte haben einen weiteren, positiven Nebeneffekt: steigende Markhor-Bestände bedeuten mehr Beute für den stark bedrohten Schneeleoparden - seine Bestände nehmen ebenfalls zu.
Weltweit existieren zahllose Beispiele, in denen Wildtiere und Menschen, die mit ihnen leben, von der Jagd direkt profitieren. Einnahmen aus lizensierter Jagd verleihen Wildtieren einen Wert, der zu ihrem und dem Schutz ihrer Lebensräume durch die lokale Bevölkerung führt. Der sogenannte "Markhor-Award", mit dem der CIC alljährlich besondere Artenschutzprojekte auszeichnet, trägt aus diesem Grund den Namen der asiatischen Wildziege.