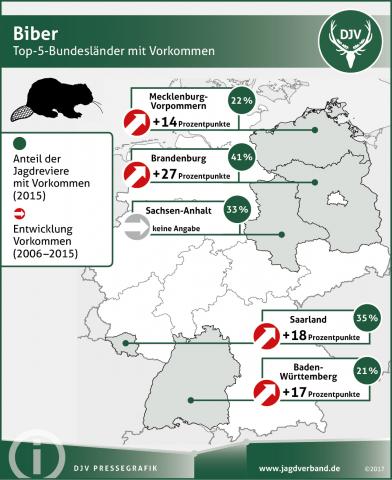Bundesregierung sieht Bestandsrückgang von Brutvögeln in der Agrarlandschaft. Monitoring-Daten der Jäger bestätigen diesen Trend für das Rebhuhn. Der DJV begrüßt, dass die Bundesregierung erstmals den Einfluss von Fressfeinden als bedeutend einstuft und fordert Lebensraumverbesserung gemeinsam mit Landwirten.
Die Zahl der Brutvögel in der Agrarlandschaft hat in den vergangenen Jahren europaweit abgenommen. In ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage hat die Bundesregierung vergangene Woche den Bestandsrückgang allein beim Rebhuhn in Deutschland von 1990 bis 2015 auf 84 Prozent beziffert. Die Daten der Jäger aus dem Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) bestätigen dies: Demnach haben Wissenschaftler im Nordwestdeutschen Tiefland, dem einstigen Hauptverbreitungsgebiet der Rebhühner, 2015 nur noch 0,53 Paare pro Quadratkilometer gezählt, wie aus dem aktuellen WILD-Bericht hervorgeht. Das sind 45 Prozent weniger als neun Jahre zuvor. Dieser Rückgang fällt zusammen mit der politisch gewollten Abschaffung der obligatorischen Stilllegungsflächen. Europaweit betroffen waren von dieser Regelung 38.000 Quadratkilometer Brachflächen, also wertvolle Lebensräume für Vogelarten der Agrarlandschaft. In Deutschland waren es 7.000 Quadratkilometer.
Bundesregierung räumt Einfluss von Fressfeinden auf Artenvielfalt ein
Als entscheidende Faktoren für den Rückgang bei den Vogelarten nennt die Bundesregierung "Lebensraumveränderungen, Verringerung des Nahrungsangebotes (insbesondere Rückgang der Insektenbiomasse) und direkte Verfolgung (Prädation)". Erstmals misst die Bundesregierung damit dem Einfluss von Fressfeinden (Prädation) eine besondere Bedeutung zu, was der DJV begrüßt. Gleichzeitig kritisiert der Verband die politisch motivierten Beschränkungen der Jagd in Naturschutzgebieten sowie der Jagd mit Fallen in einigen Bundesländern. "Wenn wir die heimische Artenvielfalt erhalten wollen, gibt es nur zwei Stellschrauben: Lebensräume erhalten und verbessern sowie Fressfeinde reduzieren“, sagte DJV-Präsidiumsmitglied Dr. Dirk-Henner Wellershoff und forderte von Politik und Behörden mehr Unterstützung.
Jäger unterstützen Projekte zur Biotopverbesserung
Jäger haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen gestartet, um Lebensräume für Offenlandarten wie Feldlerche, Kiebitz oder Rebhuhn zu verbessern. Das Ziel: die zum Teil sehr intensiv genutzten Agrarflächen wieder strukturreicher gestalten. Insbesondere Rebhühner benötigen einen hohen „Grenzlinienanteil“ aus Hecken, Rainen oder Blühstreifen, in denen sie ausreichend Wildkräuter und vor allem auch lebensnotwendige Insekten für ihre Küken finden und vor den zahlreichen Fressfeinden geschützt sind. Aktuellstes Projekt: Seit Anfang 2017 unterstützt der DJV das europäische Gemeinschaftsprojekt PARTRIDGE mit dem Ziel, die Biodiversität in verschiedenen internationalen Testflächen zu steigern. Die Lebensbedingungen der Zeigerart Rebhuhn sollen dabei durch Agrarumweltmaßnahmen beispielhaft verbessert werden. Projektträger ist die englische „Game and Wildlife Conservation Trust“, nationaler Partner die Universität Göttingen mit Projektleiter Dr. Gottschalk.
Weniger Bürokratie für mehr Artenvielfalt
Für ungenügend hält der DJV die derzeitige Umsetzung der Greening-Vorgaben aus Brüssel: Der Anbau von Zwischenfrüchten und Hülsenfrüchten (Leguminosen) hat nur geringe positive Wirkung auf die Artenvielfalt. Als Ökologische Vorrangflächen sollten viel stärker Brachen, Blühstreifen und Streifenelemente angelegt werden, die nachweislich positive Effekte auf die Biodiversität haben. Dies funktioniert laut DJV nur gemeinsam mit den Landwirten, die derzeit mit unnötigen bürokratischen Hürden und einem hohen Sanktionsrisiko konfrontiert werden. Der DJV fordert eine Vereinfachung in der Verwaltungspraxis.
Wildtierfreundliche Biomasseproduktion
Zudem macht sich der DJV im Netzwerk Lebensraum Feldflur für eine wildtierfreundliche Ergänzung der Biomasseproduktion stark: Geeignete Saatgutmischungen heimischer Wild- und Kulturpflanzen bieten innovative Ansätze, Energieerzeugung aus Biomasse enger mit den Zielen des Landschafts-, Natur- und Artenschutzes zu verknüpfen. Um kurzfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Wildpflanzen als Substrat für Biogasanlagen und die Akzeptanz des Anbausystems zu verbessern, fordert das „Netzwerk Lebensraum Feldflur“ eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Gleichzeitig sollte der Anbau von Wildpflanzen und ihre Nutzung in Biogasanlagen als ökologische Vorrangfläche im Rahmen des Greenings anerkannt werden.
Keine politischen Stolpersteine für die Jagd
Neben der Verbesserung von Lebensräumen ist die Bejagung von Fressfeinden eine wichtige Stellschraube für den Erhalt der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. Allein der anpassungsfähige Fuchs hat in den vergangenen drei Jahrzehnten seinen Bestand in Deutschland verdreifacht - dank erfolgreicher Tollwutimpfung. Hinzu kommen gebietsfremde, Fleisch fressende Arten wie Waschbär oder Mink. Die Fangjagd ist die effektivste Methode, insbesondere nacht- und dämmerungsaktive Raubsäuger zu bejagen. Der DJV macht deutlich, dass politisch motivierte Hürden für die Jagd - etwa Einschränkung in Schutzgebieten, Verkürzung der Jagdzeiten, Verbot der Fangjagd - der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft schaden.
Die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage
von Bündnis 90/Die Grünen: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/121/1812195.pdf