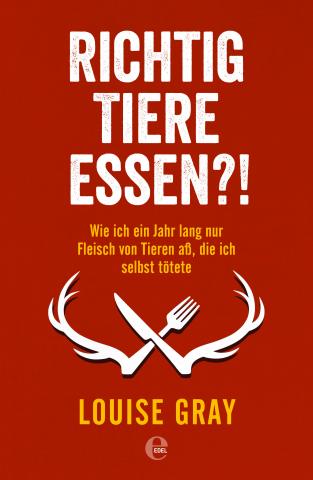DJV legt Monitoring-Daten für Waschbär, Marderhund und Mink vor. Innerhalb von neun Jahren hat der Waschbär sein Vorkommen im Kerngebiet um 32 Prozentpunkte gesteigert. Auch Marderhund und Mink breiten sich weiter aus, allerdings weniger ausgeprägt. Artenschutz: DJV fordert Erleichterungen für die Jagd auf die nachtaktiven Fleischfresser.
Seit dem Jahr 2006 überwachen Jäger systematisch die Ausbreitung von Waschbär, Marderhund und Mink in Deutschland. Wissenschaftler haben jetzt Datenreihen aus über 24.000 Revieren bis zum Jahr 2015 für das Wildtier-Informationssystem der Länder (WILD) ausgewertet. Das deutschlandweit umfangreichste Monitoring umfasst 13 Millionen Hektar - das entspricht etwa 40 Prozent der land- und forstwirtschaftlichen Fläche. Die wichtigsten Ergebnisse hat der Deutsche Jagdverband (DJV) heute veröffentlicht.
Waschbär bricht alle Rekorde
Besonders auffällig ist die Entwicklung beim Waschbären, einem nordamerikanischen Kleinbären: Er hat sich bundesweit ausgebreitet und kommt inzwischen in 43 Prozent der Reviere vor. Das sind 19 Prozentpunkte mehr als bei der ersten Erfassung im Jahr 2006. Die historisch bedingten Hochburgen Brandenburg und Hessen sind zwischenzeitlich Teil eines größeren Kerngebiets (Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern). Dort haben Jäger den Waschbär 2015 in 74 Prozent der Reviere nachgewiesen. Im Jahr 2006 haben nur 42 Prozent ein Vorkommen gemeldet.
Besonders weit verbreitet ist der Kleinbär in Sachsen-Anhalt (91 Prozent der Reviere), in Brandenburg (88 Prozent) und in Hessen (78 Prozent). Der größte Zuwachs von 2006 bis 2015 ist in Sachsen-Anhalt zu verzeichnen (plus 47 Prozentpunkte). Selbst in Baden-Württemberg (plus 14 Prozentpunkte seit 2006) und Nordrhein-Westfalen (plus 18 Prozentpunkte) ist der Waschbär auf dem Vormarsch. Die Ausbreitung macht sich auch in der Jagdstatistik bemerkbar. Bundesweit haben Jäger in der Jagdsaison 1995/96 rund 3300 Tiere erlegt. In der vergangenen Jagdsaison (2015/16) waren es 128 100, eine Rekordzahl.
Marderhund auf konstant hohem Niveau
Den aus China stammenden Marderhund haben Jäger 2015 deutschlandweit in über einem Viertel aller teilnehmenden Reviere bestätigt - eine Steigerung um 6 Prozentpunkte gegenüber 2006. Sein Vorkommen konzentriert sich hauptsächlich auf ein Kerngebiet, das Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt umfasst. Dort kommt der Marderhund in 80 Prozent der Reviere vor, das sind 16 Prozentpunkte mehr als neun Jahre zuvor.
Am häufigsten haben Jäger den Marderhund in Mecklenburg-Vorpommern (92 Prozent der Reviere) angetroffen, gefolgt von Brandenburg (84 Prozent). In Sachsen-Anhalt hat sich der Marderhund zwar nur in 64 Prozent der Reviere gezeigt, der Zuwachs war mit 29 Prozentpunkten allerdings am größten.
Gewässerspezialist Mink breitet sich langsam aus
Der Mink oder amerikanische Nerz ist als Fleischfresser an den Lebensraum Wasser gebunden. Dementsprechend ist seine flächenmäßige Ausbreitung in Deutschland begrenzt: Jäger haben ihn 2015 in 7 Prozent der Jagdbezirke nachgewiesen, das entspricht einer Steigerung von 2 Prozentpunkten gegenüber 2006.
Aus Nerzfarmen entlaufene oder von Tierschützern "befreite" Tiere haben sich unter anderem entlang der Elbe ausgebreitet und fressen bedrohte Krebse, Amphibien und Vögel. Das Hauptverbreitungsgebiet erstreckt sich von Sachsen-Anhalt über Brandenburg bis Mecklenburg-Vorpommern. Dort kommt er in 24 Prozent der Reviere vor, das sind 10 Prozentpunkte mehr als 2006.
Jäger fordern Unterstützung bei der Bejagung
Jegliche Einschränkung, die eine effektive Bejagung von gebietsfremden Arten erschwert, ist laut DJV kontraproduktiv für den Artenschutz. Dies gilt insbesondere für den Waschbären, den die Europäische Union (EU) kürzlich in die Liste der invasiven, gebietsfremden Arten aufgenommen hat. Primäres Ziel: die Eindämmung. „Wenn wir die heimische Artenvielfalt erhalten wollen, gibt es nur zwei Stellschrauben: Lebensräume erhalten und verbessern sowie Fressfeinde reduzieren“, sagt DJV-Präsidiumsmitglied Dr. Jürgen Ellenberger. Angesichts der rasanten Ausbreitung räuberisch lebender, gebietsfremder Arten und dem fortschreitenden Lebensraumverlust etwa für Arten der Offenlandschaft und Feldflur fordert der DJV eine flächendeckende Bejagung. Dies schließt insbesondere Naturschutzgebiete, befriedete Bezirke nach §6a BJagdG sowie urbane Räume ein.
Eine drastische Einschränkung der Jagdzeit für den Waschbären - wie derzeit in Hessen praktiziert - lehnen Jäger ab, sprechen sich jedoch gegen einen Vernichtungsfeldzug aus: Der Elterntierschutz gilt auch für invasive Arten. Waschbärmütter, die Junge versorgen müssen, dürfen demnach nicht bejagt werden. Ebenso unsinnig für den Artenschutz ist ein Verbot der Fallenjagd wie in Berlin oder deren Einschränkung. Denn Waschbär, Marderhund und Mink sind nachtaktiv und können mit tierschutzgerechten Fanggeräten effektiv bejagt werden.
Im Falle des Waschbären geht Dr. Ellenberger noch einen Schritt weiter: "Öffentliche Aufträge bedürfen öffentlicher Mittel, wir fordern eine finanzielle Unterstützung der Jäger.“ Dies könnten Zuschüsse für Fallen und elektronische Fallenmelder oder Fahrtgeld sein. Denn Fangjagd sei zwar eine äußerst effektive Jagdart, aber eben auch sehr kosten- und zeitaufwändig.