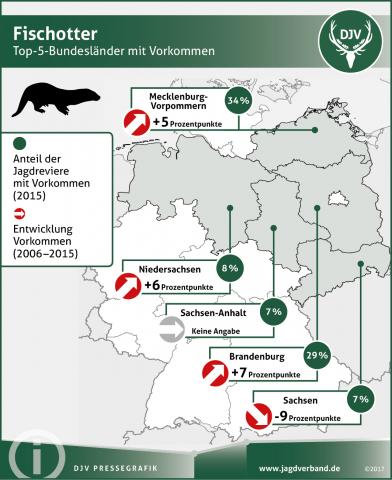Der Deutsche Jagdverband (DJV) und der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern (LJV) laden ab morgen zum Bundesjägertag nach Rostock-Warnemünde ein. Am 22. und 23. Juni 2017 werden etwa 400 Gäste aus ganz Deutschland erwartet, darunter Delegierte der Landesjagdverbände, Landes- und Bundespolitiker sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen. Unter dem Motto „Nachhaltig. Ehrlich. Wild“ stehen regionales Wildfleisch als modernes Lebensmittel und Felle aus heimischer Jagd als nachhaltige Ressource im Fokus. Im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl diskutieren führende Politiker ihre Jagdpositionen.
Am Donnerstag erarbeiten Delegierte die zukünftige Ausrichtung des Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD), für das Jäger in den vergangenen 15 Jahren bereits Daten zu Vorkommen, Ausbreitung oder Krankheiten für insgesamt 37 Tierarten erfasst haben. Vorgestellt wird auch die neu gegründete Fellwechsel GmbH: Workshop-Teilnehmer erörtern die Ausrichtung des Unternehmens, das eine nachhaltige Nutzung von Fellen aus heimischer Jagd fördern soll. Am Abend gedenken Tagungsteilnehmer bei einer Messe dem Schutzpatron der Jagd "St. Hubertus" in der Warnemünder Kirche.
Den zweiten Veranstaltungstag eröffnet der amtierende Oberbürgermeister von Rostock, Roland Methling, zusammen mit DJV-Präsident Hartwig Fischer und dem LJV-Präsidenten Dr. Volker Böhning. Delegierte diskutieren unter anderem eine Grundsatzposition Jagd. Vorgestellt wird zudem die DJV-Kampagne „Wild auf Wild“. Bei der anschließenden Verleihung des Journalistenpreises „Wildtier und Umwelt“ 2016 dürfen sich fünf Autoren über die Auszeichnung für journalistische Beiträge zum Thema Jagd und Natur freuen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 17.000 Euro.
Den öffentlichen Teil der Veranstaltung eröffnet Agrarminister Dr. Till Backhaus mit einem Grußwort. Führende Politiker aus dem Bereich der Jagdpolitik debattieren mit den Delegierten ihre Position zur Zukunft der Jagd in einer Podiumsdiskussion. Den politische Dialog im Vorfeld der Bundestagswahl können Facebook-User ab etwa 15.30 Uhr über einen Livestream mitverfolgen.
Die wichtigsten Beschlüsse veröffentlicht der DJV auf www.jagdverband.de und berichtet laufend über das aktuelle Geschehen via Facebook und Twitter unter dem Hashtag #BJT17.
Die Delegiertenversammlung findet jährlich auf dem Bundesjägertag statt und ist das höchste Beschlussgremium. Ausgerichtet wird der Bundesjägertag vom DJV und jeweils einem Landesjagdverband.