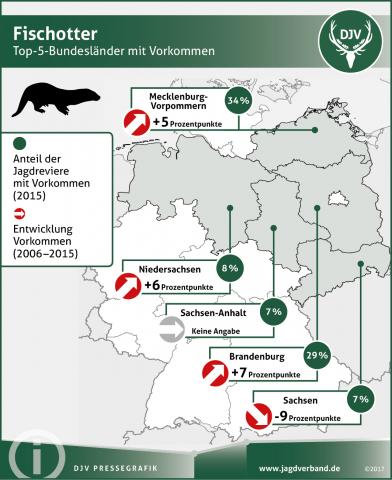"Eine Ratte ist ein Schwein ist ein Hund ist ein Mensch": Die Gründerin der Tierrechtsorganisation PETA, Ingrid Newkirk, hat diesen Satz geprägt. Dahinter steht der Gedanke, dass jedes empfindungsfähige Wesen ein Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück hat. Aus diesem Verständnis heraus protestieren Anhänger der Tierrechtsszene nicht nur gegen Jagd, sondern in letzter Konsequenz auch gegen Schädlingsbekämpfung und sogar Haustiere. Die philosophische Theorie vom allgemeinen Glücksempfinden besteht allerdings nicht den Härtetest im wahren Leben und führt Anti-Jagd-Proteste von PETA ad absurdum, meint der Deutsche Jagdverband (DJV): Der Waschbär mag Glück empfinden, wenn er vom Hunger getrieben eine seltene Rotbauchunke verstümmelt. Ebenso der Fuchs, der ein Küken der bedrohten Trauerseeschwalbe bei lebendigem Leibe frisst. Aber wie viel Glück empfinden dabei die Beutetiere?
Der DJV warnt, dass dieses Alle-sollen-glücklich-sein-Konzept zwar geeignet ist, ahnungslosen Menschen Spenden zu entlocken. Für den Artenschutz wäre es katastrophal. Anpassungsfähige Arten wie Fuchs, Marderhund oder Waschbär bedrängen spezialisierte Arten wie Kiebitz, Großtrappe oder Sumpfschildkröte. "Es gilt nach wie vor die alte Regel 'fressen und gefressen werden' – wobei die Beutetiere dabei zumeist weniger Glück empfinden", sagte DJV-Präsident Hartwig Fischer am Rande des Bundesjägertages. Deutschland habe sich vertraglich zum Erhalt der Vielfalt der Arten verpflichtet, dafür gebe es drei Stellschrauben: Klimawandel bremsen, Lebensraum verbessern und Fressfeinde reduzieren.
Die Intensivierung der Bejagung anpassungsfähiger Fleischfresser ist dringend notwendig zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Dank erfolgreicher Tollwutimpfung hat beispielsweise der Fuchs seine Bestände in Deutschland in 30 Jahren verdreifacht. Den aus Nordamerika stammenden Waschbär hat die Europäische Union mittlerweile auf die Liste der invasiven Arten gesetzt, einher geht damit die Aufgabe für Deutschland, dessen Bestand zu reduzieren. Der Waschbär kommt derzeit in 43 Prozent der Reviere Deutschlands vor. Die Zahl der erlegten Tiere stieg von 3.500 (1996) auf 128.100 (2016). Besonders effektiv für die Jagd auf die dämmerungs- und nachtaktiven Raubsäuger ist die Fangjagd.
PETA unterstellt Jägern allerdings, dass der Einsatz von Fanggeräten grausam sei. Dies ist schlicht falsch. Tierschutz hat einen hohen Stellenwert in der Ausübung einer ordnungsgemäßen Jagd. Die in Deutschland gängigsten Fallentypen hat der DJV erfolgreich nach internationalen Normen für eine humane Fangjagd (Agreement on International Humane Trapping Standards - AIHTS) prüfen lassen. Dazu gehören die Betonwipprohrfalle oder die Strack’sche Holzkastenfalle. Erfolgreich AIHTS-geprüft sind ebenfalls Totfangfallen, wie Eiabzugseisen oder „Kleiner Schwanenhals“, die auf DJV-Initiative in Kanada getestet wurden.
Die Tierrechtsszene hat übrigens jetzt eine neue fabelhafte Idee, um das Dilemma ihrer eigenen Existenzgrundlage zu lösen und allen Tieren das Streben nach Glück zu ermöglichen: Jetzt sollen Raubtiere genetisch umprogrammiert werden, damit sie gänzlich auf Fleisch verzichten. Der Wolf soll also künftig friedlich neben dem Schaf auf der Wiese weiden. "Paradise Engineering" nennt David Pearce dieses Konzept gegen "Wildtierleid".