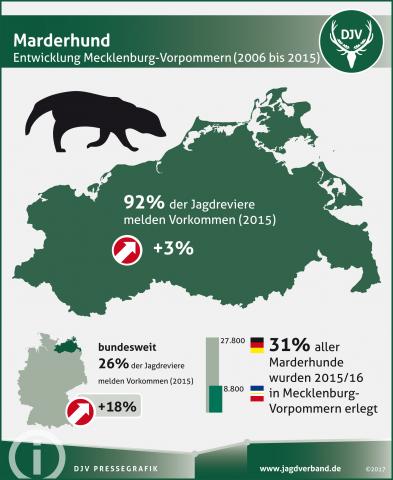Nach Prüfung zahlreich eingegangener Hinweise auf Unregelmäßigkeiten haben der Deutsche Jagdverband (DJV) und der Bayerische Jagdverband (BJV) beschlossen, die Sozialwahl bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) anzufechten. Die Verbände kündigten an, rechtzeitig Klage beim Sozialgericht zu erheben.
Betroffene, die zu Unrecht keine Wahlunterlagen erhalten haben, werden aufgerufen, die Klage mit einer eidessttatlichen Versicherung zu unterstützen. Nähere Hinweise und ein Formular gibt es unter jagdverband.de/sozialwahl2017. Geplant ist darüberhinaus alle Kreis- und Jägerschaftsvorsitzenden bezüglich der Sozialwahl durch einen Infobrief zu informieren.
Zwar waren die mit der Vorbereitung der Wahlen befassten Mitarbeiter der Sozialversicherung in vielen Fällen bemüht, eine Teilnahme zu ermöglichen, aber in zu vielen Fällen sind die Bemühungen gescheitert. Es handelt sich nicht um Einzelfälle, bei denen trotz rechtzeitiger Beantragung der Unterlagen, keine Wahlunterlagen verschickt wurden. Vielmehr haben hunderte Zuschriften die Verbände erreicht. Gerade die Hotline, die eingerichtet wurde, war oft überlastet und überfordert. "Ich weiß von einem Revierinhaber, der innerhalb von zwei Tagen 42 Mal versucht hat die Hotline zu erreichen - immer war besetzt", berichtet Friedrich von Massow, Justitiar des DJV. Eine sehr große Zahl von Wahlberechtigten hatte bis zuletzt keine Wahlunterlagen bekommen und war dadurch von der Wahl ausgeschlossen. "Manche Jagdpächter hatten nicht einmal die Möglichkeit, sich mittels Fragebogen zur Wahl zu registrieren", sagt Dr. Joachim Reddemann, Hauptgeschäftsführer des BJV. "Selbst nach vielen Anrufen bei der Hotline und Zusagen über den Versand, erhielten Pächter keine Fragebögen."
DJV und BJV bedanken sich bei mehr als 10.000 Wählern, die im Zuge der Sozialwahl ihr Kreuz bei der Liste 11 gemacht haben. Dank ihnen können die Interessen der Jäger nun zwar erstmals in die Vertreterversammlung der SVLFG eingebracht werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass bei ordnungsgemäßem Ablauf der Wahl gerade die Jägerliste einen höheren Stimmenanteil hätte erreichen können. Mit nur wenigen zusätzlichen Stimmen wären mehrere Sitze möglich gewesen.
Weitere Informationen:
Die eidesstattliche Versicherung muss sorgfältig durchgelesen werden, fahrlässige Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist strafbar. In der vorbereiteten Erklärung müssen die Passagen deutlich gekennzeichnet werden, die zutreffen (z.B. Eigenjagdbesitzer, Jagdpächter oder Ehepartner). Weiterhin müssen der Name des Jagdbezirks sowie persönlichen Daten leserlich angegeben werden. Die Versicherung muss anschließend handschriftlich unterzeichnet werden.
Die ausgefüllte eidesstattliche Versicherung bitte schnellstmöglich, spätestens bis zum 15. August 2017, an folgende Postadresse senden (im Original, nicht als Fax oder E-Mail):
Deutscher Jagdverband
Stichwort: Anfechtung der Sozialwahl 2017
Chausseestr. 37
10115 Berlin