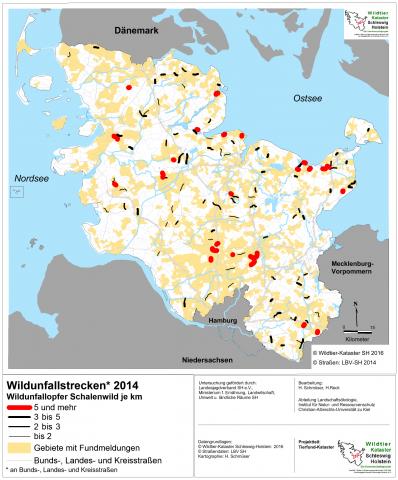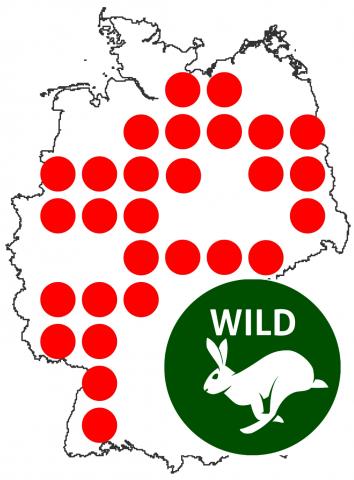DJV: Was sollten Jäger tun, wenn sie verendetes Wasserwild auffinden?
FLI: Menschen sollten tot aufgefundene Vögel nicht anfassen. Sie sollten den Fund der örtlichen Veterinärbehörde melden. Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörden (in der Regel Landkreise und kreisfreie Städte), ob sie die Jägerschaft dazu auffordern, sie beim Sammeln toter Wildvögel zu unterstützen.
Wenn Wild eingesammelt werden soll, was ist zu beachten?
Im Ernstfall gibt die zuständige Veterinärbehörde klare Regeln vor, an die sich Jäger halten sollten. Grundsätzlich gilt: Kadaver sollten nur mit Handschuhen angefasst werden, etwa mit Einmalhandschuhen aus Nitril. Der Vogelkörper sollte in einen Müllbeutel überführt und dieser anschließend verschlossen werden. Ein Tyvek-Einmalschutzanzug dient bei Sammelaktionen dazu, vor einer Kontamination der Kleidung zu schützen und das Risiko einer Verschleppung des Erregers zu mindern.
Wie sollte zum Einsammeln genutzte Kleidung gesäubert werden?
Kontaminierte Kleidung sollte bei mindestens 60°C gewaschen und Gerätschaften sowie gebrauchte Schutzanzüge sollten z.B. mit Peressigsäure oder einem anderen geeigneten Desinfektionsmittel (http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=1800) mit ausreichender Einwirkzeit behandelt werden. Einmal-Atemschutzmasken sind nach Gebrauch in einem Müllbeutel zu entsorgen. Das beim Bergen der Vögel getragene Schuhwerk ist zu reinigen und zu desinfizieren, bevor der Ort verlassen wird, an dem die Kadaver gesammelt wurden, um eine Verschleppung des Erregers zu vermeiden.
Besteht für Jäger, die Geflügel halten, ein besonderes Risiko?
Ja, in diesem Fall besteht ein großes Einschleppungsrisiko. Daher sollten insbesondere Geflügel haltende Jäger den Kontakt zu toten Vögeln meiden und sie nicht verbringen. Vor Betreten von Geflügelhaltungen müssen unbedingt die Biosicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere das Anlegen von bestandseigener Schutzkleidung und ein Schuhwechsel. Die aktuellen Hinweise der DVG für Tierhalter sollten hierbei beachtet werden: http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2119
Wie können Jäger die örtlichen Behörden beim Monitoring unterstützen?
Jäger können die Behörden unterstützen, indem sie dem Veterinäramt Totfunde von Vögeln melden. Soweit die zuständige Veterinärbehörde es anordnet, kann die Entnahme von Tupferproben aus Rachen und Kloake (kombinierter Tupfer) von geschossenen Wasservögeln das aktive Monitoring (Untersuchung von gesunden oder gesund erlegten Vögeln) unterstützen. Die Proben sollten flüssigkeitsdicht und gekennzeichnet (Name des Einsenders, Datum und Fundort) an das Veterinäramt geschickt werden.
Weitere Informationen:
Aktuelle Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes (Stand: 18. November 2016): https://www.fli.de/index.php?id=227