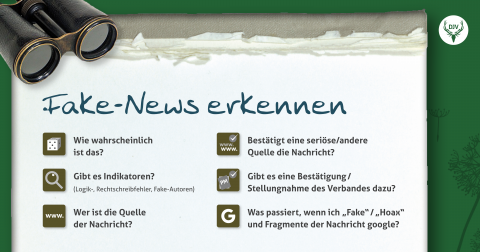DJV: Frau Agneskirchner, "Auf der Jagd - Wem gehört die Natur?" ist seit dem 10. Mai im Kino, mehr als 30.000 Besucher haben den Film bislang gesehen. Wie ist diese Zahl einzuschätzen?
Agneskirchner: Also erstmal muss und darf ich sagen, das ist ein absoluter Erfolg für diesen Film. Nach dem Tag der bundesweiten Previews am 9, Mai war "Auf der Jagd - Wem gehört die Natur?" sogar auf Platz 2 der deutschen Kino-Charts. Nach Avengers, aber vor allen anderen Hollywood-Filmen, Disney-Produktionen, Jim Knopf und Fuck U Göthe. Der Film lief in den ersten zwei Wochen in über 120 Kinos. Für einen Dokumentarfilm eine Sensation.
Sie haben selbst zahlreiche Vorführungen besucht und bei Publikumsgesprächen mit den Besuchern über den Film diskutiert. Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht?
Hier ist zum einen erstaunlich, wie viele Besucher jahrelang kein Kino mehr besucht haben, aber für diesen Film in die Kreisstadt oder in das kleine Kino im Nachbarort oder in das große Multiplex-Kino im Gewerbegebiet der nächsten Stadt gefahren sind. "Auf der Jagd - Wem gehört die Natur?" ist ein filmischer Spaziergang durch unsere Natur, mit großen Natur- und Tierbildern, den Geräuschen des Waldes und einer Musik, die genau dafür komponiert wurde. Dieses Erlebnis ist im Kino was Besonderes und ich freue mich, wenn die Zuschauer das so erleben.
Zum anderen war es toll die vielen unterschiedlichen Begleitveranstaltungen zu und mit diesem Film zu erleben. Das Spektrum reicht von Jagdhornbläsern zu Beginn als Einstimmung, Wildgulasch oder Wildbratwürste als Erlebnisgastronomie im Kino bis zu Filmgesprächen, die weit über den Filminhalt hinausgehen und einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen. Unterschiedlichste Gesprächspartner und Positionen kommen miteinander in einen Dialog. Jäger haben mit Veganern über den Sinn von Jagd diskutiert. Bauern mit Jägern und Schäfern über eine bessere Zusammenarbeit, Wolfsexperten mit Anwohnern, und Kinder haben mit ihren Eltern über ihr tägliches Essen nachgedacht. Die Themen betreffen uns alle.
Wie wird der Film von Jägern und von Nicht-Jägern wahrgenommen?
Die Frage, die Jäger und Nicht-Jäger am meisten beschäftigt, ist die gesetzliche Verordnung, dass "Wald" vor "Wild" zu stehen hat. Wie wird das geregelt? Ist es gerechtfertigt? Wer entscheidet es? Das fragen die Nicht-Jäger. Und die Jäger fragen sich davon ableitend: Ist es tatsächlich richtig so? Ist es auch richtig, dass es so viele rotwildfreie Bezirke gibt? Was haben die Jagdverbände für eine Möglichkeit das vielleicht wieder zu verändern?
Die Nicht-Jäger sind überrascht von den 1,2 Millionen Rehen, aber in der Relation zu 60 Millionen geschlachteten Schweinen ist die Nachdenklichkeit oft groß, und das regional und ethisch viel „humaner“ gewonnene Wildbret für viele die bessere Fleisch-Alternative. Beides verändert den Blick auf die Jagd bzw. die Jäger. Sein Tun wird nachvollziehbar und nicht nur als selbstherrliche Machtausübung verstanden.
Der DJV selbst hat dazu aufgerufen, Kinos vor Ort zu kontaktieren und Vorführungen anzufragen und zu organisieren. Hat das etwas bewirkt?
Viele Hegegemeinschaften oder einzelne Gruppierungen in den regionalen Jagdverbänden haben den Aufruf des DJV als Angebot wahrgenommen, ihr lokales Kino kontaktiert bzw. dem Filmverleih NFP über die Film-Website www.wemgehoertdienatur.de signalisiert, dass sie in einer bestimmten Region eine Kino-Veranstaltung machen wollen. Viele Kino-Abende, -Nachmittage oder Sonntagsmatineen mit Wildbret und Gesprächen sind dadurch erst möglich geworden.
Es gibt sicherlich viele, die bislang keine Zeit oder Möglichkeit hatten, für den Film ins Kino zu gehen. Was kann man hier noch anbieten?
Der Film ist nun in der 5. Woche im Kino. Das bedeutet, dass die Anzahl der Kinos geringer wird, die den Film ohne spezielle Gruppenveranstaltungsanfrage in ihrem Programm anbieten. Viele andere Filme drängen nun in deren Programm, aber wenn es die Gruppenanfragen gibt, wird jedes Kino sofort bereit sein, eine Sonderveranstaltung mit ins Programm zu nehmen. Es kommt also auf die Jagdverbände, Naturschutzverbände und Landwirtschaftsverbände an, eine Person zu finden, die sich in ihrem Kreis, in ihrem Hegering dazu bereit erklärt, zusammen mit dem Verleih eine solche Veranstaltung zu organisieren. Ich war bei 17 dieser Veranstaltungen dabei. Keiner ist davon unberührt geblieben, jeder hat etwas aus dem Film und den Gesprächen mit nach Hause genommen. Einen neuen Blickwinkel, eine Nachdenklichkeit, eine Freude und ein Gefühl, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Ein wichtiges Gefühl für Jäger und Nicht-Jäger.
Sie sind in einer Jägervereinigung und möchten ebenfalls eine Aktion in einem Kino in der Nähe veranstalten?
Jägerinnen und Jäger, die eine Sonderaktion planen wollen, können direkt den Kinobetreiber vor Ort kontaktieren oder sich mit Fragen und Anregungen an Jonas von Fehrn-Stender vom Filmverleih NFP wenden: E-Mail j.fehrn-stender@nfp.de; Telefon (0 30) 2 32 55 42 48.