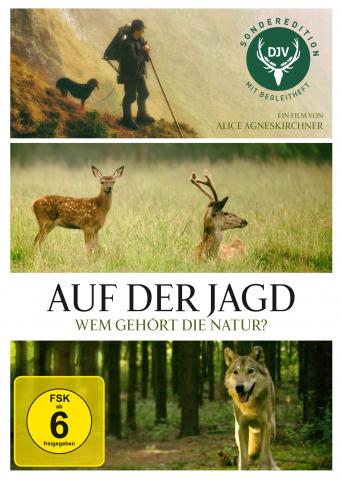Zum Auftakt des Treffens präsentierte DJV- und FACE Vizepräsident Dr. Volker Böhning die klaren politischen Forderungen der deutschen Jäger (Link) für ein effizientes Wolfsmanagement. Eine Aktualisierung des strengen Schutzstatus des Wolfs ist bei dessen rasanter Vermehrung und Ausbreitung und der nicht mehr hinnehmbaren Probleme für Landwirte und Tierzüchter dringend notwendig. Er kritisierte sowohl das Bundesumweltministerium als auch das Bundesamt für Naturschutz in Deutschland und forderter sie zu einer realistischeren Beurteilung der Situation des Wolfes in Europa und Deutschland auf. Der günstige Erhaltungszustand der Wolfspopulation im Nordosten Deutschlands lasse sich nicht mehr bestreiten und es sei Zeit für ein aktives Wolfsmanagement auf jagdrechtlicher Grundlage. Die oftmals angepriesenen Präventivmaßnahmen für die Weidetierhaltung sind weder praktikabel noch finanzierbar.
Dr. Jörg Friedmann, Landesjägermeister Baden-Württemberg, berichtete über Wolfsrisse in Baden-Württemberg. Er wies auf den Widerspruch zwischen der Einsperrung des Rotwilds in administrativ abgegrenzte Gebiete und der freien Rückkehr des Wolfes hin. Das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz in Baden-Württemberg sei auch für eine Art wie den Wolf das passende Managementinstrument. Für Wölfe müssten die gleichen Regeln des Wildtiermanagements gelten. Er forderte insbesondere mehr Flexibilität für Entscheidungen der Mitgliedsstaaten. Dies wäre über eine ordnungsgemäße Anwendung des Artikels 19 der FFH-Richtlinie zu erreichen.
Des weiteren standen die Anliegen der Jägerschaft bezüglich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 auf der Agenda. Es müssen klare Natur- und Biodiversitätsziele in der GAP enthalten sein, damit die Landwirte für die Erzeugung von Lebensmittel und Ökosystemleistungen gleich welchen Umfangs belohnt werden, da diese für die allgemeine Gesellschaft einen Mehrwert erbringen. Dem dramatische Niedergang des Niederwildes und anderer, nicht jagdbarer, Arten. muss entgegengetreten werden. Dr. Friedmann verwies hier auf das Projekt „Allianz für Niederwild“ und die Eröffnung der ersten Modellregion auf den Fildern. Mehrjährige Blühflächen kombiniert mit Brachen stellen beispielsweise hervorragende Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen für Rebhühner dar. Zugunsten unserer Wildtiere müssen die Jäger künftig noch engere und stärkere Allianzen mit den Organisationen der primären Landnutzer schmieden. Praxisorientierte Umsetzungsmöglichkeiten müssten in der kommenden Förderperiode der GAP dafür als Grundlage vorhanden sein.
Ludwig Willnegger, FACE-Generalsekretär, und Friedrich von Massow, Justiziar DJV, erklärten zuletzt, dass der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Belgien dramatische Folgen für die Jagd und Schweinewirtschaft bedeuten können. Die Jägerschaft sei bereit, ihren Beitrag bei der Bekämpfung zu leisten. Die Kommission dürfe hier keine Scheu haben entsprechenden Gegenmassnahmen finanziell zu unterstützen. Sie betonten aber, dass die Prävention der Einschleppung enstcheidend sei. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in West- und Mitteleuropa nicht durch die Wildschweinpopulation, sondern durch den Faktor Mensch aus.
Dr. Friedmann lud EU-Kommissar Oettinger zur Teilnahme am Landesjägertag am 6. April 2019 in Sigmaringen ein.