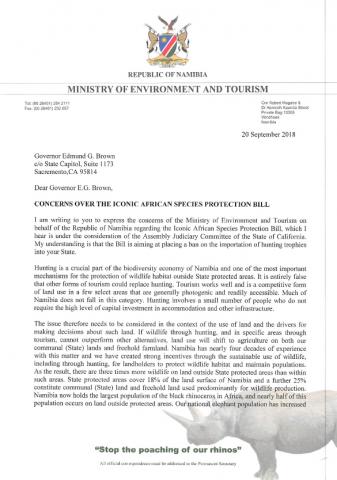Seit Ende August 2018 steht fest, dass das ursprünglich aus Afrika stammende West-Nil-Virus Deutschland erreicht hat. Speziell Greif- und Rabenvögel scheinen für das Virus empfänglich zu sein. Aktuell wurde die Krankheit auch erstmals bei einem Menschen in Deutschland festgestellt. DFO und DJV fordern zu erhöhter Wachsamkeit auf und geben Tipps zur Erkennung und im Umgang mit tot aufgefundenen Vögeln.
Apathie, Gewichtsverlust, Blindheit, Tod: Was Ende August mit einem eingegangenen Bartkauz aus Halle (Saale) begann, wird von Falknern in Deutschland mit Sorge betrachtet. Die Eule ist nachweislich am West-Nil-Virus (WNV) gestorben. Empfänglich für das erstmals 1937 in Uganda nachgewiesene Virus sind anscheinend vor allem Greifvögel, Eulen und Rabenvögel. In Bayern ist ein Tierarzt wenige Tage nach der Obduktion eines Bartkauzes an West-Nil-Fieber erkrankt, mittlerweile aber wieder genesen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgte die Übertragung des Virus durch direkten Kontakt mit erregerhaltigen Körperflüssigkeiten des verendeten Vogels. Der Deutsche Falkenorden (DFO) und der Deutsche Jagdverband (DJV) weisen darauf hin, dass tot aufgefundene Vögel mit unklarer Todesursache nur mit Handschuhen angefasst, in Plastiktüten auslaufsicher verpackt und an die zuständigen Veterinäruntersuchungsämter weitergeleitet werden sollten. Da es sich bei WNV bei Vögeln um eine anzeigepflichtige Tierseuche handelt, müssen bereits bei Verdachtsfällen die Veterinärbehörden informiert werden. Tot aufgefundene Wildvögel können auch per App an das Tierfundkataster (www.tierfund-kataster.de) des DJV übermittelt werden.
Aktuell berichten deutsche Medien, darunter das Spiegel-Magazin, von mehreren nachgewiesenen Fällen des WNV in Deutschland: allesamt Bartkäuze, Amseln und Habichte. Anders als die Bartkäuze, die aus Wildparks stammen, handelt es sich bei den Amseln und dem Habicht um tot aufgefundene Wildvögel. Die Untersuchung durch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) ergaben bisher bereits über zehn positive WNV-Nachweise bei Vögeln aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Berlin, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. In einer Meldung aus Tschechien an den DFO ist von acht Todesfällen und fünf schweren Erkrankungsfällen bei Beizhabichten durch WNV innerhalb von nur zwei Wochen die Rede.
In Europa trat das Virus erstmals Anfang der 1960er Jahre in Frankreich auf und hat sich seitdem im gesamten Mittelmeerraum etabliert. Regelmäßig werden vor allem aus süd- und südosteuropäischen Ländern Krankheitsfälle gemeldet. Auch Menschen und Pferde können sich infizieren und erkranken. In den USA tritt das Virus seit 1999 auf und sorgt unter Greifvögeln wie Weißkopfseeadlern, Buntfalken und amerikanischen Sperbern für teils hohe Verluste. Auch Kondore sind betroffen. Als Hauptüberträger gelten Stechmücken und in einigen Fällen auch Zecken.
Die meisten infizierten Vögel entwickeln keine klinisch sichtbare Erkrankung (subklinische Infektion). Bei klinisch erkrankten Vögeln können Apathie, Störungen des Nervensystems sowie Blindheit und Gleichgewichtsstörungen festgestellt werden. Greifvögeln und Eulen, Rabenvögel wie Krähen oder Elstern und Gänse zählen zu den Vogelgruppen, bei denen regelmäßig schwere und teils tödlich verlaufenden Erkrankungen durch WNV beschrieben werden. Eine Infektion bei Menschen äußert sich in grippeähnlichen Symptomen, wodurch eine Erkrankung bis heute meist erst spät und generell nur selten erkannt wird. Die Infektionen verlaufen laut Robert-Koch-Institut überwiegend klinisch unauffällig.
Im Interview mit Dr. Dominik Fischer, Fachtierarzt für Reptilien und für Wirtschafts-, Wild- und Ziergeflügel an der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fischer der Justus-Liebig-Universität Gießen, beleuchten DFO und DJV weitere Hintergründe des West-Nil-Virus und liefern Empfehlungen für die Betreiber von Auffangstationen, Falkner, Jäger und andere Naturschützer.
DFO/DJV: Greifvogel gefunden- was tun?
Dr. Dominik Fischer: Wichtig ist, ruhig zu bleiben. Lässt sich ein Vogel greifen, dann tut man das aus Gründen des Eigenschutzes am besten unter Zuhilfenahme einer Jacke oder Decke und befördert den Patienten in einen Umzugskarton zum nächstmöglichen, vogelkundigen Tierarzt. Tote Vögel sollte man nur mit Handschuhen anfassen. Traut man sich einen Transport selbst nicht zu, meldet man ein solches Tier am besten der zuständigen Behörde - also den Veterinärämtern, Forstämtern oder Naturschutzbehörden. Auch Jagdpächter, Falkner oder deren Auffangstationen sind gute Adressen, wenn es um hilfsbedürftige Vögel geht. Der Grund für die Erkrankung bzw. den Tod eines Vogels muss nicht zwangsweise eine Seuche sein, sondern kann auch alltägliche Gründe wie die Kollision mit einer Scheibe oder einem Auto haben. Auch Vergiftungen sind denkbar. Allerdings ist in Anbetracht der potentiellen Gefahr einer Infektionskrankheit des Tieres die Einhaltung hygienischer Grundsätze dringend zu empfehlen. Dies beinhaltet die Entsorgung von Einmalgegenständen (z.B. Einmalhandschuhe und Karton) sowie die gründliche Reinigung und Desinfektion der Hände und aller Kontaktflächen. Eine Liste mit geprüften Desinfektionsmittel findet man auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts sowie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG), wobei man im Falle von WNV unter der Kategorie „behüllte Viren“ nachschlagen sollte.
Das West-Nil-Virus ist recht neu. Besteht jetzt Grund zur Panik?
Erstmal nein. Bis dato gibt es erste bestätigte Fälle des WNV in Deutschland und es werden spätestens in den nächsten Jahren noch einige Folgen. WNV hat sich in benachbarten Ländern bereits seit längerem etabliert und es war nur eine Frage der Zeit bis es in Deutschland ausbricht. Für Auffangstationen und Falkner rate ich zur Ergreifung vorbeugender Maßnahmen: Behältnisse mit Regenwasser nicht stehen lassen und Wasser regelmäßig tauschen. Damit soll vermieden werden, dass Stechmücken als Hauptüberträger des WNV ihre Eier ablegen und sich vermehren können. Außerdem sollten Haltungseinrichtungen wie Kammern, Flugdrahtanlagen oder Volieren mit mückensicheren Netzen abgehangen werden. Das Absammeln von Zecken ist ohnehin immer ratsam.
Hat der Sommer 2018 die Verbreitung des Virus begünstigt?
Das ist anzunehmen. Auch wenn Niederschläge rar waren - Teiche, Gräben und andere stehende Gewässer sind nicht ausgetrocknet, wodurch die Mücken ideale Brutbedingungen hatten. Je mehr Mücken desto mehr potentielle Zwischenwirte („Vektoren“) und desto höher das Übertragungsrisiko. Dieses sinkt jedoch meist zum Winter hin rapide ab. Da das Virus in seinen Wirten überwintern kann, ist die Gefahr in Deutschland jedoch nach wie vor da. Wärmephasen auch im Winter sorgen dafür, dass Stechmücken fliegen und aktuell ein Restrisiko besteht.
Können erkrankte Wildvögel behandelt werden? Können Beizvögel von Falknern prophylaktisch behandelt werden?
Auch wenn es keine kausale Therapie gegen diese Viruserkrankung gibt, so kann versucht werden erkrankte Tiere symptomatisch zu behandeln, was aber meist eine intensiv-medizinische Betreuung notwendig macht. Diese Patienten benötigen Infusionen, entzündungshemmende Medikamente, meist eine Zwangsernährung und müssen ruhig untergebracht werden. Ein Therapieerfolg kann keinesfalls garantiert werden, da er sich maßgeblich nach der individuellen Abwehrlage und Konstitution des Tieres richtet. Studien an Großfalken haben ergeben, dass eine Impfprophylaxe mit verschiedenen Impfstoffen bei Greifvögeln möglich ist. Jedoch müssen hierfür Pferdeimpfstoffe durch den Tierarzt für die betreffende Vogelart umgewidmet werden. Ich empfehle jedoch unabhängig davon hohe Hygienestandards im Umfeld von Stationen und Haltungseinrichtungen anzusetzen und auch bei der Beizjagd klinisch verdächtige Beutevögel zu meiden.

 schechien, eine aus Deutschland - bliesen um den Titel. Der internationale Wettbewerb zeichnete sich durch ein sehr hohes Niveau und besondere Leistungsdichte aus. Die Richter bestätigten den Thüringer Jagdhornbläsern musikalische Ausdrucksstärke, Entschlossenheit, jugendliche Frische, freundliches und bescheidenes Auftreten mit Höchstpunktzahlen. Auch die Reaktion des Publikums ließ bereits während des Vortrags den Erfolg erahnen. Die feierliche Preisverleihung fand in der Basilika von Levoča, gelegen am Fuße der hohen Tatra, im Anschluss an eine Hubertusmesse statt.
schechien, eine aus Deutschland - bliesen um den Titel. Der internationale Wettbewerb zeichnete sich durch ein sehr hohes Niveau und besondere Leistungsdichte aus. Die Richter bestätigten den Thüringer Jagdhornbläsern musikalische Ausdrucksstärke, Entschlossenheit, jugendliche Frische, freundliches und bescheidenes Auftreten mit Höchstpunktzahlen. Auch die Reaktion des Publikums ließ bereits während des Vortrags den Erfolg erahnen. Die feierliche Preisverleihung fand in der Basilika von Levoča, gelegen am Fuße der hohen Tatra, im Anschluss an eine Hubertusmesse statt.