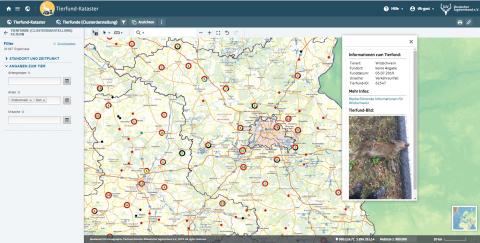Die Ankündigung der botswanischen Regierung, das seit 2014 bestehende Jagdverbot aufzuheben, sorgt für internationale Furore. Tierrechtsorganisationen werden nicht müde die botswanische Regierung anzugreifen. Medien beteiligen sich an der emotional geführten Debatte.
Im Interview mit CIC und DJV erläutert der Tiermediziner und Wildtierspezialist Dr. Erik Verryenne, der seit 2002 in Botswana forscht und arbeitet, die Hintergründe für die Wiedereinführung der Jagd. Er ist kein Jäger, sieht in der Jagd aber ein wichtiges Artenschutz-Instrument.
DJV/CIC: Botswana ist das elefantenreichste Land der Welt. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Dr. Erik Verreynne: Die Zahl der Dickhäuter stieg von 55.000 im Jahr 1990 auf über 120.000 im Jahr 2012. 17 Prozent Botswanas sind als Nationalpark ausgewiesen, in denen mindestens 25.000 Elefanten leben. Weitere 72.000 Elefanten leben in sogenannten „Wildlife Management Areas“, die 32 Prozent der Landesfläche ausmachen. Nochmals 27.000 Elefanten bewegen sich außerhalb dieser Gebiete. Rechnerisch ergibt das 1,2 Elefanten pro Quadratkilometer, die sich Wasser und Land mit Menschen teilen müssen, die von der Landwirtschaft abhängig sind. Die Bauern Botswanas leben im Durchschnitt 400 bis 500 Meter von einem Elefanten entfernt. 40 Menschen wurden in den vergangenen zehn Jahren von Elefanten getötet, die meisten in der Zeit des Jagdverbots. Fakt ist: Botswana hat mehr Elefanten, als wir vertragen.
DJV/CIC: Wie hat sich die Elefanten-Population seit Einführung des Jagdverbots entwickelt?
Dr. Erik Verreynne: Die Population gilt seit 2012 als stabil, ohne dass es zur Zeit des Jagdverbots zu einem wahrnehmbaren Anstieg gekommen wäre. Die vor dem Jagdverbot gemeldeten Fälle von Elefantenwilderei waren im Vergleich zu anderen Teilen Afrikas unbedeutend, nach Einsetzen des Jagdverbots stieg die Wilderei zwischen 2014 und 2018 stark an. Weil sich die Elefanten immer weiter in Botswana ausbreiten, vergrößern sich auch die Konfliktgebiete und belasten die Anti-Wilderei-Programme Botswanas enorm. Trotz des Jagdverbots blieb der Druck bei den Elefanten aufgrund der Wilderei, der Konkurrenz um Nahrung und Wasser und der damit notwendigen weiten Wanderungen, hoch. Übrigens: Auch die Anzahl von Büffeln und anderen Wildarten wuchs bis 2014 signifikant, während des Jagdverbots setzte sich der Trend aber nicht fort.
DJV/CIC: Wie steht Botswana zu dem Jagdverbot von 2014?
Dr. Erik Verreynne: Das Jagdverbot vom Januar 2014 war ein Marketing-Instrument, mit dem der Fototourismus angekurbelt werden sollte. Jagd störte und passte nicht in das angestrebte Bild Botswanas als "sicherer Hafen für die Elefanten des südlichen Afrika". Die Jagd als Einnahmequelle wurde ohne angemessene Einbeziehung der betroffenen Menschen einfach ausgesetzt. Florierende gemeindebasierte Ressourcenmanagementprogramme brachen zusammen. Zusagen, wonach ehemals in der Jagd Beschäftigte in der Tourismusbranche unterkommen würden, wurden nicht eingehalten. Übergangsfonds zur Unterstützung des Übergangs vom Jagd- zum Fototourismus wurden - obwohl versprochen- nie gebildet. Internationale Unterstützung, die an das Jagdverbot geknüpft war, kam nie an.
DJV/CIC: Konnte der Fototourismus den Wegfall der Einnahmen aus Jagd kompensieren?
Dr. Erik Verreynne: Die Fotosafari-Industrie trägt maßgeblich zum Bruttoinlandsprodukt Botswanas bei. Aber die Einnahmen aus dem Fototourismus kommen nicht bei den Menschen an. Die angebotenen Arbeitsplätze reichen nicht aus und die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Nicht alle für die Jagd erforderlichen Fähigkeiten finden in der Tourismusbranche Verwendung. Nicht alle Dorfbewohner können Englisch oder haben Fähigkeiten, die ausländischer High-End-Tourismus fordert.
DJV/CIC: Warum ist es notwendig, die Jagd wieder zuzulassen? Warum gefährdet man das Image Botswanas und riskiert einen Tourismusboykott?
Dr. Erik Verreynne: Die Antwort ist eigentlich sehr einfach: Das Jagdverbot ist gescheitert, es hat mehr geschadet als genutzt. Das Jagdverbot hat es nicht geschafft, Menschen, Elefanten und andere Wildtiere zu schützen, im Gegenteil. Das fragile, auf Toleranz und finanziellem Wert basierende Miteinander von Mensch und Tier ist empfindlich gestört, Mensch-Wildtier-Konflikte eskalieren. Mittel für Entschädigungen waren bald erschöpft. Viele Jagdkonzessionen, die für Fotosafaris ungeeignet waren, verwaisten und wurden wegen fehlender Berufsjäger zu Zufluchtsorten für Wilderer. Wo die Jagd aufgegeben wurde, wurde die künstliche Wasserversorgung im Winter eingestellt und die Elefanten wichen auf menschliche Siedlungen und deren Brunnen aus.
DJV/CIC: Wie steht man in Botswana zu der westlichen Kritik?
Dr. Erik Verreynne: Die Kritik, die an Botswana und Präsident Masisi wegen der Aufhebung des Jagdverbotes geäußert wird, ist hart und ungerecht. Es gibt ja den Vorwurf, wonach die Aufhebung des Jagdverbots nur politisch motiviert sei. Im positiven Sinne stimmt das auch. Die Kommunen nutzen ihr Recht und drängen ihre Parlamentsabgeordneten, sich mit dem Thema zu befassen. Es folgt eine demokratische Volksabstimmung und über 90 Prozent der Befragten sprechen sich für die Jagd und sogar für die Keulung von Elefanten aus. Nach einem weiteren Konsultationsprozess beschließt das Kabinett einen verantwortungsvollen Kurs für Land und Leute: Es befürwortet die Jagd, lehnt aber die Keulung ab und will parallel auf alternative, nicht-lethale Methoden bei der Bewältigung der überwältigenden Herausforderung im Elefantenschutz setzen. Ich frage mich: Warum begrüßt man in westlichen Medien den Einfluss von Umweltfragen bei EU-Wahlen, verunglimpft aber den Einfluss von Umweltfragen auf Wahlen in Botswana? Warum opfert man die Prinzipien der Demokratie und Souveränität, wenn das Ergebnis nicht nach dem eigenen Geschmack ist?
DJV/CIC: Welches Ziel verfolgt Botswana mit der Wiedereinführung der Jagd?
Dr. Erik Verreynne: Botswana kann, wie viele andere Länder Afrikas, kein "sicherer" Hafen für alle Elefanten dieser Welt sein. Unser Land ist kein Großwildreservat, Konflikte sind unvermeidlich und real. Man kann kein Mitgefühl von uns erwarten, wenn Menschen verletzt und getötet, Ernten zerstört und Vieh zerfleischt wird. Man kann von uns kein Mitgefühl für die Tierwelt erwarten, wenn wir nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause gefangen sind. Im ländlichen Afrika basiert Empathie auf dem Wert eines Tieres. Botswana beabsichtigt, gemäß der CITES-Exportquote für Elfenbein weniger als 400 Elefanten pro Jahr erlegen zu lassen. Die Jagd ist also kein Instrument der Bestandsbewirtschaftung, da mit diesem Eingriff nicht einmal der Zuwachs abgeschöpft wird. Jagd wird dort eingesetzt, wo Elefanten aus Problemgebieten vertrieben werden sollen. Die Aufhebung des Jagdverbots wird den am stärksten von Mensch-Wildtier-Konflikten betroffenen Gemeinden ein alternatives Einkommen bieten, insbesondere in Gebieten, in denen Tourismus allein nicht nachhaltig gewährleistet werden kann. Sie wird nachhaltige Alternativen zur Wilderei und zum Handel mit Buschfleisch bieten. Die Regierung formuliert Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass die Einnahmen aus der Jagd an die Gemeinden weitergeleitet werden. Sie führt Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Jagd auf Grundlage von Forschung erfolgt und sich nicht negativ auf den Artenschutz auswirkt.
Dr. FJ (Erik) Verreynne qualifizierte sich 1990 als Tierarzt an der Fakultät für Tiermedizin der Universität Pretoria. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit verschiedenen Aspekten des Naturschutzes, der Immobilisierung von Wildtieren, des Managements und der Forschung im südlichen Afrika. Seit 2002 ist er in Botswana ansässig. Er kennt die Region, das Land und seine Umgebung. Er ist als Tierarzt beim Botswana Veterinary Medical Board, dem South African Veterinary Council und dem Royal College of Veterinary Surgery registriert. Er ist Mitglied der South African Veterinary Association Wildlife Group, Mitglied des technischen Ausschusses der Kalahari Conservation Society und Mitglied des Botswana Rhino Management Committee und ist als Wildfangoperator in der Republik Botswana registriert. Er absolvierte einen M. Phil. (Wildlife Management)-Abschluss an der University of Pretoria und beschäftigt sich mit einem laufenden Forschungsprojekt zur Aktualisierung der zentralen Datenbank für Südliche Breitmaulnashörner (Ceratotherium simum) in Privatbesitz in Botswana, wobei die genetischen Variationen in der Population untersucht werden, um sie als Managementinstrument in einem nationalen Zuchtmanagementansatz zu nutzen. Er hat ein großes Interesse an der Überwachung von Tierkrankheiten und fördert die Einrichtung eines entsprechenden Zentrums in Botswana.