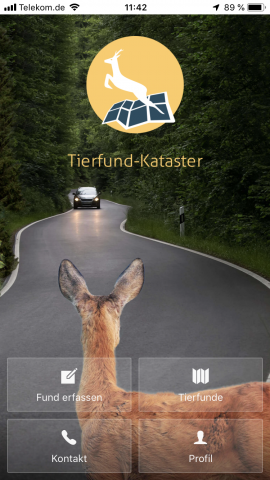Den besten deutschen Jagdfilm hat YouTuber Felix Kuwert aus Bayern gedreht: Für "Jagd - eine Liebe zur Natur" erhielt er am vergangenen Freitag den Sophie-Award. Den Preis haben der Deutsche Jagdverband (DJV) und die Firma Jagdstolz ins Leben gerufen. Er zeichnet die Filme aus, die die Jagd für die Öffentlichkeit am besten verständlich machen. "Ein Nicht-Jäger steigt in Felix Kuwerts Film zunächst völlig normal ein. Das, was am Anfang steht, kann jeder erleben. "Dann wechselt die Perspektive hin zur Jagd. Das macht diesen Film sehr stark“, so das Votum der Jury. Den zweiten Platz belegte Christian Schmidt aus Brandenburg mit seinem Film "Waidgerechtigkeit - Der Zeit waidgerecht". Der dritte Platz ging an den YouTuber Rouven Kreienmeier aus Nordrhein-Westfalen für seinen Film "Das erste Mal auf Jagd". Insgesamt hatten 22 Filmemacher 4 bis 10-minütige Filme für den Wettbewerb eingereicht. Im Berliner Kant-Kino lief die Premiere der besten zehn Filme.
Wettbewerbskriterium für den Sophie-Award war die Richtlinie "Waidgerechtigkeit 2.0". Sie dient als neuer Leitfaden und Qualitätsstandard für Jägerinnen und Jäger in den sozialen Medien. "Mit dieser Richtlinie verpflichten wir uns selbst, unser Waidwerk mit demselben Maß an Respekt und Verantwortung in den sozialen Medien darzustellen, wie wir es ausüben", sagte DJV-Präsident Dr. Volker Böhning bei der Eröffnung der Veranstaltung. Das Töten von Tieren gehöre zur Jagd, es gelte, dies nicht zu verstecken. Jagd dürfe jedoch nicht darauf reduziert werden, so Dr. Böhning.
Zu der hochkarätigen Sophie-Award-Jury zählten Jagdbuchautor und Journalist Bertram Graf von Quadt, die Herausgeberin des Magazins "Halali" Ilka Dorn, der Berliner Schauspieler Florian Panzner, Journalistin und Reden-Expertin Jacqueline Schäfer, Filmemacher und Regisseur Marcel Wehn, Deutschlands jüngster Tier- und Naturfilmer Clemens Keck sowie DJV-Ehrenpräsident Hartwig Fischer.
Etwa 250 Menschen nahmen an der Verleihung im Berliner Kant-Kino teil, 13 Sponsoren aus dem Bereich Jagd und Outdoor flankierten den Wettbewerb, (DJV-Shop, OBT-Shop, Sauer und Sohn, Swarovski Optik, Hanwag, Outfluence, Gothaer, Gruma Hunter, Puma Knives, Hornady, Westho, Fendt und Fellwechsel). Die Verleihung wurde live auf Facebook übertragen.
Alle Gewinnerfilme werden am Mittwoch, den 17. Juli um 19.00 Uhr auf YouTube veröffentlicht.
Instagram: https://www.instagram.com/dersophieaward/
Facebook: https://www.facebook.com/dersophieaward/