Spätestens seit der Industrialisierung wird Jagd zunehmend kritisch betrachtet: Für die einen gibt es nichts ursprünglicheres als dem Wild nachzustellen, für andere ist es ein unnötiges und herzloses Hobby. Ein häufiger Vorwurf lautet: Jäger jagen nur der Trophäe wegen oder aus reiner "Lust am Töten". Der Jäger und Biologe Hans-Dieter Pfannenstiel setzt sich in seinem Buch "Heute noch jagen? Das Waidwerk - geliebt und geächtet" mit dieser Thematik auseinander. Auf rationaler Ebene begründet der emeritierte Professor, warum die Jagd in unserer Kulturlandschaft notwendig ist. Er bettet das Thema in seinen Kenntnishorizont aus Bio- und Ökologie, Land- und Forstwirtschaft. Mit dieser selbstreferenziellen Perspektive deckt er sachlich und korrekt den aktuellen Wissensstand ab. Er untermauert seine Argumentation durch eigene Fotos, viele aus seinem Revier.
Pfannenstiel kritisiert zudem Traditionen und Bräuche, besonders wenn sie nicht (mehr) im Einklang mit naturwissenschaftlichen Fakten stehen. Hier sieht er Aufklärungspotenzial innerhalb der Jägerschaft. Er setzt sich dafür ein, dass Wald nicht vor Wild gesetzt wird, da radikale Abschüsse zur Dezimierung von Wildschaden nicht immer sinnvoll sind. Auch vertritt er die Meinung, dass Jäger ihr Tun stets hinterfragen sollten und dass sich mit der Veränderung der Kulturlandschaft auch die Jagd verändern muss.
Insgesamt setzt sich Pfannenstiel mit seinem Buch "Heute noch jagen?" sehr umfassend mit dem Thema Jagd und deren Einflüsse und Bedeutungen auf die Kulturlandschaft auseinander. Allerdings geht er bei Beschreibungen von Vorgängen in der Natur und der jagdlichen Praxis stellenweise sehr ins Detail. Trotz der Begriffserklärungen am Ende des Buches benötigt der Leser ein gewisses Grundwissen der Ökologie und Jagd um seinem Werk ausreichend folgen zu können - ein Jagdschein ist von Vorteil. Dies macht das Buch nicht weniger lesenswert, könnte aber dafür sorgen, dass Leser, die normalerweise nichts mit Jagd zu tun haben, abgeschreckt werden. Wir finden trotzdem: ein umfangreiches Buch, dass den einen oder anderen Jäger zum Nachdenken bringen kann.



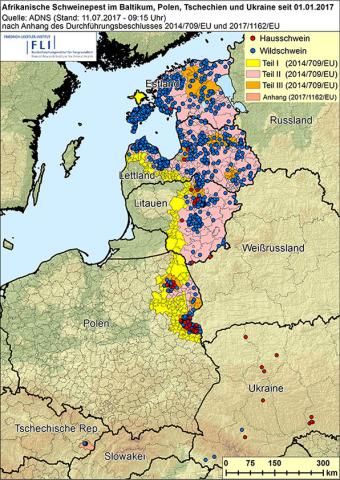 «Das Virus ist ein cleverer Erreger», sagte Mettenleiter. «Es vermehrt sich in den Zellen, die eine Immunantwort vermitteln wollen.» Der Erreger habe dabei verschiedene Mechanismen entwickelt, um einer immunologischen Reaktion zu entkommen. Weltweit wird nach Angaben Mettenleiters an einem Impfstoff geforscht. Es gebe aber bislang noch kein Mittel, das in die Nähe einer Einsatzfähigkeit komme. Infizieren sich Schweine mit ASP, ist die Sterblichkeit hoch.
«Das Virus ist ein cleverer Erreger», sagte Mettenleiter. «Es vermehrt sich in den Zellen, die eine Immunantwort vermitteln wollen.» Der Erreger habe dabei verschiedene Mechanismen entwickelt, um einer immunologischen Reaktion zu entkommen. Weltweit wird nach Angaben Mettenleiters an einem Impfstoff geforscht. Es gebe aber bislang noch kein Mittel, das in die Nähe einer Einsatzfähigkeit komme. Infizieren sich Schweine mit ASP, ist die Sterblichkeit hoch.