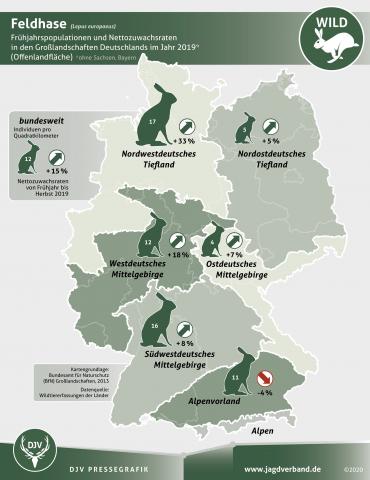Auch in Corona-Zeiten kommt es bei der Mahd von Grünland oder Energiepflanzen wie Grünroggen auf die Kitzrettung an. Die Frühjahrsmahd fällt zusammen mit der Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere, die in Wiesen und Grünroggen ihren Nachwuchs sicher wähnen. Doch „Ducken und Tarnen“ schützt zwar vor dem Fuchs, nicht aber vor dem Kreiselmäher oder dem Mähbalken. Darauf machen Bundesverband Lohnunternehmen (BLU), Bundesverband der Maschinenringe (BMR), Deutscher Bauernverband (DBV) und Deutscher Jagdverband (DJV) aufmerksam. Die Verbände empfehlen den Landwirten, den Mähtermin mindestens 24 Stunden vorher mit dem Jagdpächter abzusprechen oder selbst erforderliche Maßnahmen für den Schutz von Wildtieren durchzuführen.
Tierschutz planen
Effektiver Wildtierschutz beginnt bereits vor der Mahd, so die Verbände. Entscheidend ist dabei, die anstehenden Grünschnitt-Termine – für Silage als Futtermittel oder zur Biomasseproduktion – rechtzeitig mit dem Jagdpächter abzustimmen und die Mähweise dem Tierverhalten anzupassen. Die Verbände empfehlen, das Grünland grundsätzlich von innen nach außen zu mähen. Das ermöglicht Rehen, Feldhasen oder Fasanen während der Mahd die Möglichkeit zur Flucht. Bei der Ernte der Ganzpflanzensilage verspricht die Begrenzung der Schnitthöhe auf etwa 15 bis 20 Zentimeter in der kritischen Aufzuchtzeit zusätzlichen Erfolg – gerade bei Rehkitzen, die sich instinktiv ducken, oder auch bei Bodenbrütern.
Eine Maßnahme pro Hektar hilft bereits
Vor dem eigentlichen Mähtermin haben sich verschiedene Maßnahmen bewährt, um Tierleben zu schützen. Dazu gehören auch in Corona-Zeiten mit dem gebotenen Sicherheitsabstand zum Mitstreiter etwa das Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden. Knistertüten, Flatterbänder oder Kofferradios, die bereits am Vorabend aufgestellt werden, sind ebenfalls effektiv und kostengünstig: Rehe zum Beispiel sind beunruhigt und bringen ihren Nachwuchs in Sicherheit. Elektronische Wildscheuchen, die unterschiedliche Töne wie Menschenstimmen, klassische Musik oder Motorengeräusche aussenden, haben sich im Praxiseinsatz bewährt. Bereits eine Maßnahme pro Hektar zur Vertreibung wirkt, haben Experten herausgefunden.
Drohnen für große Flächen
Abhängig von der Witterung können vor allem Drohnen helfen, die nach Ergebnissen des Konjunkturbarometer Agrar in fast jedem 10. landwirtschaftlichen Betrieb im Einsatz sind. In Kombination mit Infrarot-Technik helfen sie, Jungtiere auf großen Flächen zu lokalisieren. Derartige Maßnahmen sind wichtig, um tierschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Die Verbände fordern die Politik auf, der Forschungs- und Innovationsförderung zum Schutz von Wildtieren eine hohe Priorität einzuräumen. Besonders digitale Techniken und verbesserte Infrarottechnik haben das Potential, Rehkitze und Niederwild nachhaltig schützen zu können.
Die richtige Frühmahd wird im folgenden Video erklärt: