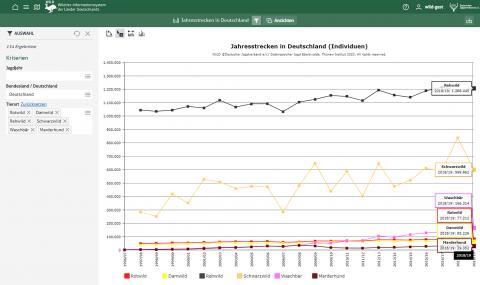Der DJV und seine Landesjagdverbände trauern um Dr. Gerhard Frank. Der passionierte Jäger ist im Alter von 90 Jahren verstorben.
Dr. Gerhard Frank, Ehrenpräsident des Deutschen Jagdverbandes (DJV), des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) und Träger des großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist am 29. Mai 2020 verstorben. Der Deutsche Jagdverband (DJV) und seine Landesjagdverbände trauern um eine der prägendsten Leitfiguren der deutschen Jägerschaft. "Wir werden uns an Dr. Gerhard Frank als beeindruckende Persönlichkeit und leidenschaftlichen Jäger erinnern und sein jahrzehntelanges Engagement in hohen Ehren halten", so DJV-Präsident Dr. Volker Böhning.
Dr. Frank, Sohn eines Oberforstmeisters und promovierter Jurist, war von 1982 bis 1995 Präsident des Deutschen Jagdverbandes. Er war zudem Präsident des bayerischen Landesjagdverbandes und Ehrenpräsident beider Verbände. Von 1979 bis 1996 führte er die Deutsche Delegation des Internationalen Rats zur Erhaltung der Jagd und des Wildes (CIC). Anschließend war er Ehrenmitglied. Als Präsident stand er dem Europäischen Dachverband der Jäger (FACE) von 1985 bis 1988 vor. Dr. Frank engagierte sich ebenfalls im Vorstand der Heinz-Sielmann-Stiftung und später in deren Stiftungsrat.
Der passionierte Jäger und Wegbereiter für die Jagd in Deutschland starb nach einem aktiven Leben, in dem er sich mit ganzer Kraft der Jagd, dem Naturschutz und dem Forst gewidmet hat. Dr. Frank war maßgeblich an der Vorbereitung der naturschutz- und jagdrechtlichen Gesetzgebung beteiligt. Diese, die Naturschutz- und Umweltbildung sowie Fragen zur Jagdethik und Jagdkultur waren seine Wirkungsbereiche, auf denen er sich national wie international Anerkennung erwarb. National erzielte er mit der Zusammenführung der deutschen Jagdverbände einen seiner größten Erfolge: So unterstützten westdeutsche Landesjagdverbände mit Patenschaften den Auf- und Ausbau der ostdeutschen Verbandsstruktur. Ein einheitlicher, großer DJV, dem die große Mehrheit der Jäger angehört, sei in der Lage, die jagdlichen Probleme der Zukunft zu meistern, so Dr. Frank in seinem Werk "135 Jahre organisierte Jägerschaft in Deutschland". In diesem beschrieb er die Geschichte und Entwicklung der Jagd und des Verbandswesens in Deutschland.
Für seine umfassenden Leistungen und sein reges Wirken wurde er sowohl in Deutschland als auch im Ausland vielfach ausgezeichnet. Dr. Gerhard Frank war Träger des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland sowie des Bayerischen Verdienstordens. Zudem erhielt er im Laufe seines wirkungsvollen Lebens zahlreiche Auszeichnungen: unter anderem das DJV-Verdienstabzeichen in Gold, die Ehrennadel in Gold des Bundes bayerischer Berufsjäger, die Ehrennadel in Gold des LJV Bayern, den Niedersächsischen Preis für Jagd und Naturschutz und die Verdienstnadel in Gold der Heinz-Sielmann-Stifung. 1996 ehrte das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Dr. Gerhard Frank mit seiner höchsten Auszeichnung – der Professor-Niklas-Medaille in Gold.