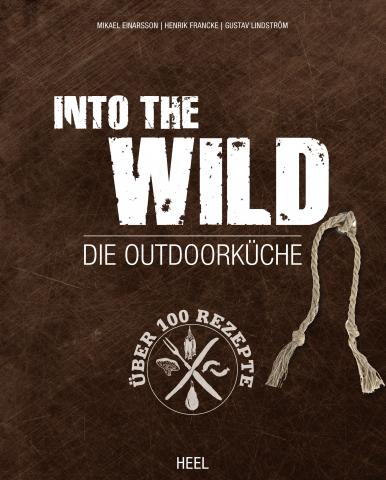Sabine Sauer, Europameisterin im jagdlichen Schießen, im Interview mit dem DJV
Seit Sonntag ist Sabine Sauer aus Rheinland-Pfalz Europameisterin im jagdlichen Schießen. Knapp 40 Punkte trennen sie von der internationalen Konkurrenz – eine bemerkenswerte Leistung. Eigentlich wollte die 26-Jährige den Jagdschein nie machen, sagt sie im DJV-Interview: „Aus Angst vorm Schießen."
DJV: „Frau Sauer, Sie haben die Konkurrenz deklassiert, wie fühlt sich das an?“
Sauer: „Unglaublich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe vorher noch nie etwas gewonnen, außer vielleicht eine Landesmeisterschaft. Weil da generell nur wenige Frauen antreten, war das keine wirkliche Konkurrenz. Hier dann gleich so abzuräumen, ist unfassbar.“
„Hat sich Ihr Sieg schon im Verlauf des Wettkampfes abgezeichnet?“
„Erstmal nicht, weil ich gleich mit einer Fahrkarte gestartet bin (Anm. d. Red.: Treffer außerhalb der Ringe). Die meisten Punkte holt man aber beim Schrot und das hat gut funktioniert. Mit 23 von 25 Tauben lag ich gut im Rennen. Beim letzten Durchgang habe ich gemerkt, dass es gut läuft und habe vor Nervosität nur 21 von 25 Tauben geschossen, aber das hat gereicht. So richtig geglaubt, habe ich es erst, als ich auf dem Treppchen stand und die Nationalhymne gehört habe. Das war überwältigend.“
„Wie häufig trainieren Sie?“
„Seit ich letztes Jahr zur Bundeswehr gegangen bin, hab ich so gut wie gar nicht mehr trainiert, weil ich keine Zeit hatte. Einige Disziplinen habe ich erst kurz vor dem Wettkampf trainiert, weil wir sie in Deutschland gar nicht schießen, etwa die Gams stehend angestrichen am Pirschstock oder Parcours.“
„Was haben Sie dieses Mal anders gemacht als bei der EM vor zwei Jahren?“
„Ich glaube, ich bin nicht so verbissen rangegangen wie in Estland, wo ich nur den fünften Platz belegt habe. Diesmal war einfach jeder Tag so gut wie der andere. Keine Ahnung, wie das ging.“
„Wie läuft der Wettkampf ab?"
„Man erhält eine Startzeit und muss dann mit der gesamten Rotte am Start sein. Dabei hat man für jede Disziplin nur fünf Minuten Zeit – zum Laden und für die fünf Schuss. Diesen Zeitdruck gibt es in Deutschland nicht.
„Womit schießen Sie?“
„Bei den Büchsendisziplinen mit einer Remington 700 im Kaliber .222, beim Schrot mit einer Browning F25 im Kaliber 12/70.“
„Welche Disziplin schießen Sie am liebsten?“
„Am liebsten schieße ich Parcours, aber eigentlich bin ich in allen Disziplinen „Trainingsweltmeister“. Auf Wettkämpfen bin ich meistens so aufgeregt, dass ich die Ergebnisse aus dem Training nicht wiederholen kann. Es ist ja eigentlich nicht schwer, aber wenn dann das Herz flattert, dann fangen auf einmal die Scheiben an, Samba zu tanzen.“
„Können Sie sich noch daran erinnern, als sie das erste Mal geschossen haben?“
„Das war als ich meinen Jagschein gemacht habe – vor fünf oder sechs Jahren. Ein Jahr später habe ich mit dem Leistungsschießen begonnen. Günther Degen, mein Betreuer, hat mich unter seine Fittiche genommen. So bin ich von Anfang an auf Meisterschaften mitgefahren – im ersten Jahr auch gleich zur Bundesmeisterschaft. Natürlich habe ich nichts getroffen. Aber so hat sich der Ehrgeiz entwickelt und so fing das harte Training an.“
„Ihre Begeisterung für den Schießsport hat der Jagdschein geweckt?“
„Genau. Und den wollte ich eigentlich gar nicht machen, weil ich Angst vorm Schießen hatte.“
„Das müssen Sie jetzt erklären.“
„Mein Vater ist Förster und wir hatten ein Gespräch über Waffen und Erbe. Zuerst hatte ich nur die Sachkunde gemacht. Und dann hat er mich einfach für den Jagdschein angemeldet.“
„Jagen und schießen gilt immer noch als Männerdomäne. Wie ist das für Sie?“
„Die Bundeswehr gilt ja auch als Männerdomäne. Ich habe bisher keine Probleme gehabt. Es kann sein, dass man sich ein bisschen mehr behaupten muss, um dieselbe Anerkennung zu bekommen, aber ausgegrenzt wurde ich nie. Ganz im Gegenteil, gerade die Gruppe mit der ich zusammen zum Schießen fahre, ist wie meine zweite Familie.“
„Europameistertitel in der Tasche, wie geht es weiter?“
„Im Moment bemerke ich eine erhöhte Aufmerksamkeit, aber ansonsten läuft jetzt alles ganz gewohnt weiter. Ich bemühe mich, dass ich den Erfolg nutzen kann und vielleicht meinen Arbeitgeber überzeugen kann, mich zu unterstützen, da ich auch Mitglied im Nationalkader bin. Ansonsten genieße ich das alles noch ein bisschen.“
„Noch einen abschließenden Satz?“
„Ich danke meiner Familie, allen die mitgefahren sind, meiner zweiten Familie sozusagen und allen, die das jagdliche Schießen unterstützen. Vor allem danke ich aber Peter Clemens und Günther Degen. Und ich wünsche mir, dass mehr Frauen den Weg in den jagdlichen Schießsport finden.“
Zur „Kombination“ im jagdlichen Schießen gehören: Bockscheibe angestrichen auf 100 Meter, Fuchs liegend auf 100 Meter, Gams angestrichen am Pirschstock auf 100 Meter, stehender Überläufer auf 100 Meter stehend freihändig und laufender Doppelkopfkeiler auf 50 Meter stehend freihändig, sowie zwei Durchgänge à 25 Trap und 25 Parcours-Tauben.