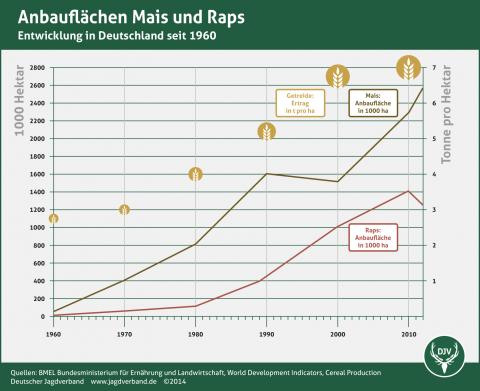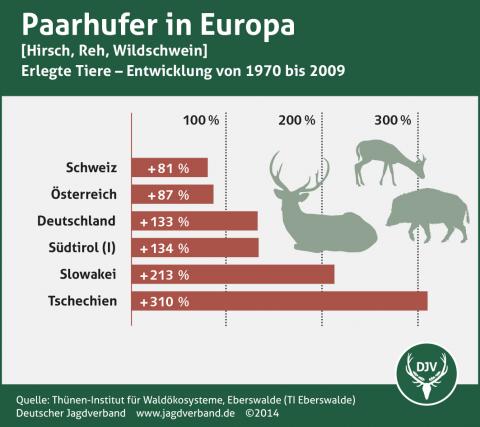Der Deutsche Jagdverband (DJV) und das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) zeigen sich erstaunt über ein Bündnis der Naturschutzverbände Nabu und BUND mit erklärten Jagdgegnern in Nordrhein-Westfalen. Es ist laut AFN und DJV ein gefährlicher Irrweg und das falsche Signal, mit Tierrechtsorganisationen wie „Peta“ und „Menschen für Tierrechte“ auf Landesebene Allianzen für eine Jagdreform einzugehen, weil ebendiese für jeden nachlesbar die Abschaffung der Jagd fordern. DJV-Präsident Hartwig Fischer sagte dazu: „Fundamentalistische Organisationen, die dem Menschen das Recht abstreiten, Tiere zu nutzen, sind keine Partner für eine geplante Jagdreform.“
AFN und DJV fordern Nabu und BUND auf, den Kurs in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg zu korrigieren: Eine erfolgreiche Jagdreform ohne den ehrlichen Dialog mit den tatsächlich Betroffenen wird es nicht geben. „Jagdrecht ist Eigentumsrecht, und das seit der Revolution von 1848. Vier Millionen Menschen und ihre Familien besitzen forst- oder landwirtschaftliche Flächen und somit das Jagdrecht. Das lassen sie sich nicht einfach wegnehmen“, betonte der AFN-Vorsitzende Philipp Freiherr zu Guttenberg. Jagd sei notwendig, um Wildschäden und Seuchen zu verhindern und den Artenschutz zu fördern. Den meisten Grundbesitzern sei dies bewusst, so Fischer und Freiherr zu Guttenberg: „Genau deshalb haben bisher nur wenige Menschen ihre Grundstücke befrieden lassen.“ Die bei Behörden vorliegenden Anträge summieren sich nach DJV-Hochrechnung auf weniger als 0,1 Promille der bundesweiten Jagdfläche von knapp 32 Millionen Hektar.
DJV und AFN machten deutlich, dass beim Jagdrecht das Verhältnis zwischen Einschränkungen und Freiheiten nicht aus dem Gleichgewicht geraten darf. In Baden-Württemberg droht dies der Fall zu werden, wie ein Fachartikel von Professor Michael Brenner, Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Jena, zeigt. Sein Fazit: Jagdrecht sei Teil des Eigentumsrechts. Geplante Einschränkungen wie ein pauschales Fütterungsverbot oder eine Jagdruhe auf Schwarzwild stellten erhebliche Eingriffe dar. Grundsätzlich seien die Beschränkungen begründungsbedürftig, nicht die Jagd selbst.
DJV und AFN wenden sich nicht per se gegen Änderungen des Jagdgesetzes. Anpassungen sind ein normaler Vorgang, seit 1952 wurde das Bundesjagdgesetz mehrmals novelliert, zuletzt 2013: Die Befriedung von Grundstücken aus Gewissensgründen wurde eingeführt. Zu Biologie und Einfluss von Wildtieren in unserer Kulturlandschaft besteht nach Ansicht von AFN und DJV weiterer Forschungsbedarf. Etwa, um wissensbasierte und praxisorientierte Grundlagen für eine Jagdrechtsreform zu schaffen. Die beiden Verbände laden Nabu und BUND ein, die Wildtierforschung partnerschaftlich zu forcieren.
Die im AFN zusammengeschlossenen 19 Verbände der Grundeigentümer und Landnutzer – Bauern, Waldbesitzer, Gärtner, Winzer, Grundbesitzer, Jagdgenossenschaften, Jäger, Reiter und Fischer – sind überzeugt, dass nur durch die nachhaltige Naturnutzung die bestehende Kulturlandschaft mit ihrer Vielfalt an Arten und Biotopen erhalten werden kann. Das AFN vertritt insgesamt mehr als 6 Millionen Menschen des ländlichen Raums. Der DJV vertritt als Dachverband rund 245.000 Jäger in Deutschland.

 Der
Der