Hauskatzen sollten künftig nach Ansicht niederländischer Juristen nicht mehr umherstreunen dürfen. Die Tiere gefährdeten die Artenvielfalt insbesondere von Vögeln, begründen Arie Trouwborst und Han Somsen von der Universität Tilburg ihren radikalen Vorstoß. Rechtliche Handhabe für ein solches Verbot bieten demnach Richtlinien der Europäischen Union. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bewertet die Forderung skeptisch. «Das Katzenproblem muss man ernst nehmen», sagt Nabu-Vogelexperte Lars Lachmann. Ein Ausgehverbot könne bei der Gefährdung lokaler Populationen mancherorts durchaus sinnvoll sein. Flächendeckend sei eine solche Maßnahme rechtlich aber nicht begründbar.
Trouwborst und Somsen argumentieren in einem kürzlich im «Journal of
Environmental Law» veröffentlichten Beitrag, Katzen seien eine
invasive Art, die vor Jahrtausenden von Vorderasien nach Europa
gebracht wurde. Inzwischen zählten sie global zu den am weitesten
verbreiteten Räubern und richteten riesige Schäden an. Dies liege
auch daran, dass die Tiere sehr zahlreich seien und eine wesentlich
höhere Populationsdichte aufwiesen als Fleischfresser ähnlicher
Größe. In Deutschland schätzt der Nabu ihre Zahl auf etwa 15
Millionen - davon seien 1 bis 2 Millionen verwildert.
«Weltweit waren Hauskatzen an der Ausrottung von mindestens 2
Reptilienarten, 21 Säugetierarten und 40 Vogelarten beteiligt - das
heißt an 26 Prozent aller bekannten derzeitigen Ausrottungen in
diesen Tiergruppen», schreiben Trouwborst und Somsen. «Derzeit
stellen Hauskatzen eine Gefahr für mindestens 367 bedrohte Arten
dar.»
Mit Zahlen aus den USA unterstreicht das Duo die Größenordnung. Dort
töten Katzen demnach jährlich geschätzt knapp 100 bis 300 Millionen
Amphibien, rund 260 bis 820 Millionen Reptilien, 1,3 bis 4 Milliarden
Vögel und 6,3 bis 22,3 Milliarden Säugetiere. Nabu-Experte Lachmann
schätzt, dass Katzen in Deutschland pro Jahr 25 bis 100 Millionen
Vögel - bei einem Gesamtbestand von 500 Millionen - erlegen. «Das ist
schon eine große Zahl.»
Trouwborst und Somsen verweisen nicht nur auf jagende Tiere: Schon
die Gegenwart einer Katze verschrecke Vögel und gefährde den
Bruterfolg etwa von Amseln und Rauchschwalben. Die Folgen seien für
die Bestände ähnlich gravierend wie die Jagd selbst, so die Autoren.
Ihr Vorschlag: Streunende und verwilderte Katzen sollten aus der
Landschaft nach Möglichkeit entfernt werden, Besitzer sollten ihre
Tiere nicht mehr nach draußen lassen - es sei denn angeleint oder in
Gehegen.
Die juristische Grundlage für ein derart radikales Vorgehen liefern
die Forscher mit - etwa die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Artikel 6
sowie 22b, dem zufolge eingeführte Arten die heimische Fauna nicht
gefährden dürfen. Zusätzlich biete die Vogelschutz-Richtlinie,
Artikel 2 und 5, eine Handhabe: Insbesondere Artikel 5 fordert ein
Verbot des absichtlichen Störens, Tötens oder Fangens von Vögeln.
«Die Richtlinien decken eine große Bandbreite ab», sagt Jan-Henrik
Meyer vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in
Frankfurt. «Die Forscher liefern das argumentative juristische
Rüstzeug für ihre Durchsetzung.» Ob das aber im Einzelfall juristisch
standhalte, sei offen.
Dass Katzen einzelne Individuen geschützter Tierarten töten, ist für
Lachmann keine Grundlage für ein generelles Ausgehverbot. Dann müsse
man auch gegen alle Fensterscheiben in Gebäuden vorgehen - dadurch
kommen laut Nabu hierzulande jährlich rund 100 Millionen Vögel ums
Leben. Wenn Katzen aber lokal Bestände geschützter Arten bedrohe,
befürworte der Nabu auch strenge Maßnahmen.
Trouwborst und Somsen halten es für kaum verständlich, dass
Interessen von Hauskatzen über denen der von ihnen gefährdeten Arten
stünden. Auch die Privatinteressen der Katzenhalter wögen nicht
schwerer als das öffentliche Interesse an einem Erhalt der
Artenvielfalt. Dennoch stellen sie fest: «Nach unserem Wissen hält
derzeit nicht ein einziger Mitgliedsstaat Katzenhalter davon ab, ihre
Haustiere streunen zu lassen» - obwohl die EU-Schutzbestimmungen dies
verlangten.
Warum kein Staat gegen Katzen vorgehe? «Wir spekulieren, dass die
Zurückhaltung der EU-Mitgliedsstaaten, das Hauskatzenproblem effektiv
anzugehen, zumindest teilweise von der vermutlichen Unpopularität
solcher Handlungen in manchen Teilen der Gesellschaft herrührt»,
schreiben die Juristen und betonen, dies erkläre zwar die
Untätigkeit, rechtfertige sie aber keineswegs.
Max-Planck-Forscher Meyer verweist darauf, dass die EU den
Vogelschutz durchaus ernst nehme. So zog die EU-Kommission seit den
1980er Jahren verschiedene Mitgliedsstaaten wie Belgien, Italien und
Frankreich vor den Europäischen Gerichtshof und verlangte, die
Vogelschutz-Richtlinie angemessen in nationales Recht umzusetzen und
die Jagd auf Vögel zu unterbinden. Die Länder mussten ihre Gesetze
überarbeiten. Zwar blieben Ausnahmeregelungen, doch generell ging der
Vogelfang laut Meyer zurück.

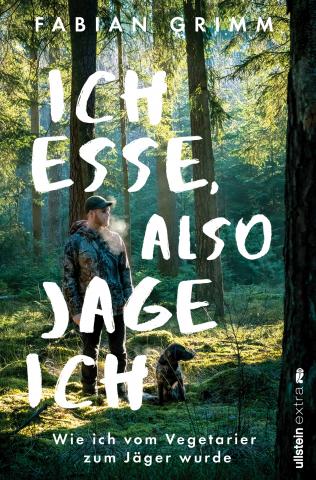 Macht Fabian Grimm das Jagen Spaß? "So einfach ist das nicht", schreibt er und versucht damit am Ende seiner Erzählung eins der großen Paradoxe der Jagd einem Nicht-Jäger zu erklären. "Spaß und Jagd, das ist ein schwieriges Thema. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich gerne jage, dann klingt das, als ob ich gerne Tiere töte. Aber das ist nicht, auf keinen Fall. Es ist mehr, es ist dieses ganze Lebensgefühl. Es macht Spaß, mich in die Tiere hineinzuversetzen, wo sie sich zu welcher Jahreszeit aufhalten und welchen Einfluss das Wetter auf ihr Verhalten hat. [...] Ein Gefühl, das davon lebt, dass ich auf der einen Seite genau weiß, wo das Fleisch herkommt und wie und wo ich das Reh erlegen konnte, und auf der anderen Seite im Hinterkopf schon überlege wie ich es zubereiten möchte? Stolz? Innere Ruhe? Vorfreude? Keiner dieser Begriffe scheint wirklich zu passen." Immer wieder versucht Grimm hervorzugehen, wie schwer es ist die richtigen Worte und Erklärungen zu finden, um Nicht-Jägern die Jagd zu erklären. Ein anderes Problem das deutlich wird, ist die weitgehende Unzugänglichkeit zur Jagd: Die meisten Jäger sind sehr herzlich und freundlich, doch benötigt es oft Kontakte oder viel Glück um das erste Mal zu einer Jagd eingeladen zu werden.
Macht Fabian Grimm das Jagen Spaß? "So einfach ist das nicht", schreibt er und versucht damit am Ende seiner Erzählung eins der großen Paradoxe der Jagd einem Nicht-Jäger zu erklären. "Spaß und Jagd, das ist ein schwieriges Thema. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich gerne jage, dann klingt das, als ob ich gerne Tiere töte. Aber das ist nicht, auf keinen Fall. Es ist mehr, es ist dieses ganze Lebensgefühl. Es macht Spaß, mich in die Tiere hineinzuversetzen, wo sie sich zu welcher Jahreszeit aufhalten und welchen Einfluss das Wetter auf ihr Verhalten hat. [...] Ein Gefühl, das davon lebt, dass ich auf der einen Seite genau weiß, wo das Fleisch herkommt und wie und wo ich das Reh erlegen konnte, und auf der anderen Seite im Hinterkopf schon überlege wie ich es zubereiten möchte? Stolz? Innere Ruhe? Vorfreude? Keiner dieser Begriffe scheint wirklich zu passen." Immer wieder versucht Grimm hervorzugehen, wie schwer es ist die richtigen Worte und Erklärungen zu finden, um Nicht-Jägern die Jagd zu erklären. Ein anderes Problem das deutlich wird, ist die weitgehende Unzugänglichkeit zur Jagd: Die meisten Jäger sind sehr herzlich und freundlich, doch benötigt es oft Kontakte oder viel Glück um das erste Mal zu einer Jagd eingeladen zu werden.