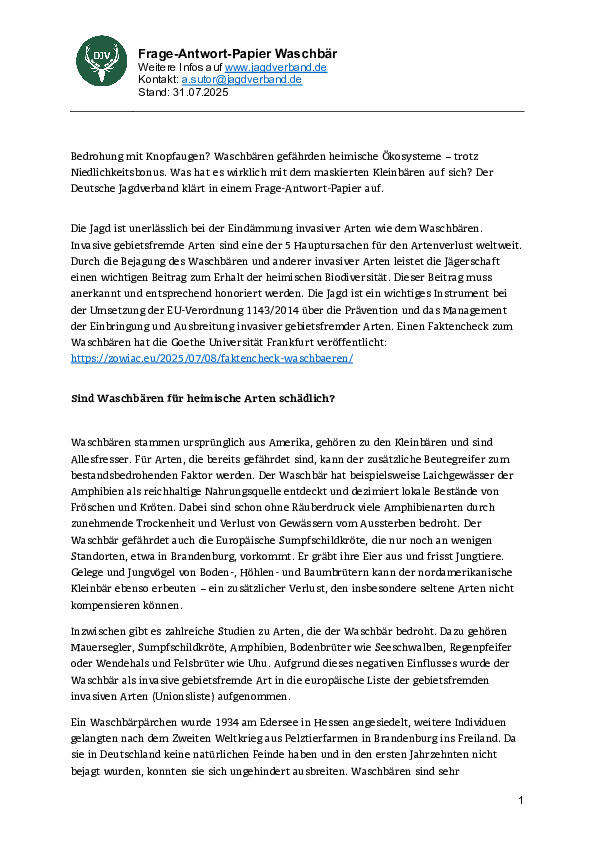Frage-Antwort-Papier zum Waschbär

Die Jagd ist unerlässlich bei der Eindämmung invasiver Arten wie dem Waschbären. Invasive gebietsfremde Arten sind eine der 5 Hauptursachen für den Artenverlust weltweit. Durch die Bejagung des Waschbären und anderer invasiver Arten leistet die Jägerschaft einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der heimischen Biodiversität. Dieser Beitrag muss anerkannt und entsprechend honoriert werden. Die Jagd ist ein wichtiges Instrument bei der Umsetzung der EU-Verordnung 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten. Einen Faktencheck zum Waschbären hat die Goethe Universität Frankfurt veröffentlicht.
Sind Waschbären für heimische Arten schädlich?
Waschbären stammen ursprünglich aus Amerika, gehören zu den Kleinbären und sind Allesfresser. Für Arten, die bereits gefährdet sind, kann der zusätzliche Beutegreifer zum bestandsbedrohenden Faktor werden. Der Waschbär hat beispielsweise Laichgewässer der Amphibien als reichhaltige Nahrungsquelle entdeckt und dezimiert lokale Bestände von Fröschen und Kröten. Dabei sind schon ohne Räuberdruck viele Amphibienarten durch zunehmende Trockenheit und Verlust von Gewässern vom Aussterben bedroht. Der Waschbär gefährdet auch die Europäische Sumpfschildkröte, die nur noch an wenigen Standorten, etwa in Brandenburg, vorkommt. Er gräbt ihre Eier aus und frisst Jungtiere. Gelege und Jungvögel von Boden-, Höhlen- und Baumbrütern kann der nordamerikanische Kleinbär ebenso erbeuten – ein zusätzlicher Verlust, den insbesondere seltene Arten nicht kompensieren können.
Inzwischen gibt es zahlreiche Studien zu Arten, die der Waschbär bedroht. Dazu gehören Mauersegler, Sumpfschildkröte, Amphibien, Bodenbrüter wie Seeschwalben, Regenpfeifer oder Wendehals und Felsbrüter wie Uhu. Aufgrund dieses negativen Einflusses wurde der Waschbär als invasive gebietsfremde Art in die europäische Liste der gebietsfremden invasiven Arten (Unionsliste) aufgenommen.
Ein Waschbärpärchen wurde 1934 am Edersee in Hessen angesiedelt, weitere Individuen gelangten nach dem Zweiten Weltkrieg aus Pelztierfarmen in Brandenburg ins Freiland. Da sie in Deutschland keine natürlichen Feinde haben und in den ersten Jahrzehnten nicht bejagt wurden, konnten sie sich ungehindert ausbreiten. Waschbären sind sehr anpassungsfähig und leben sowohl in urbanen Bereichen als auch in der Agrarlandschaft, vorzugsweise in Wäldern mit Laubbäumen und Gewässern. Als wendige Kletterer suchen sie ihre Nahrung nicht nur am Boden, sondern auch in Baumhöhlen und Felsnischen und eröffnen sich als Nahrungsopportunisten eine breite Palette. Auf dem Speiseplan stehen zum Beispiel Obst, Kleinsäuger, Insekten, Amphibien und Vögel.
Ausgewählte Quellen:
Heßler, N. & Quillfeldt, P. (2018): Nistkästen als ökologische Fallen und was sich dagegen tun läßt. Vogelwarte 56: 29-32: https://www.zobodat.at/pdf/Vogelwarte_56_2018_0029-0032.pdf
Schneeweiß, N. (2016): Waschbären (Procyon lotor) erbeuten Erdkröten (Bufo bufo) in großer Zahl am Laichgewässer. Zeitschrift für Feldherpetologie 23: 203–212 Oktober 2016: https://shop.laurenti.de/media/pdf-Dateien/ZfF2016-2-05%20-%20Schneeweiss-abstract.pdf
Schneeweiß, N. & Wolf, M. (2009): Neozoen – eine neue Gefahr für die Reliktpopulationen der Europäischen Sumpfschildkrötein Nordostdeutschland. Zeitschrift für Feldherpetologie 16: 163-182: https://www.laurenti.de/pdf-Dateien/2009-02%2002-Schneewei%df%20%26%20Wolf-abstract.pdf
Lübcke, W. (2018): Zum Einfluss des Waschbärs (Procyon lotor) auf die heimische Vogelwelt – eine Dokumentation. Vogelkundliche Hefte Edertal 44: https://nabu-waldeck-frankenberg.de/tl_files/fM_k0002/Bilder_Themen/Neubuerger/VHE44%20Waschbaer%20Luebcke.pdf
Steigert die Bejagung nicht die Vermehrung und wirkt damit kontraproduktiv?
Dieses oft genutzte Argument basiert auf einer Fehlinterpretation der Studie von Robel et al. aus dem Jahr 1990 und wird seitdem regelmäßig wiederholt und als Tatsache dargestellt. Es gibt bisher keine wissenschaftliche Studie, die bestätigt, dass Waschbären Populationsverluste durch eine erhöhte Reproduktionsrate ausgleichen würden. Eine deutsche Studie zeigt vielmehr, dass es hinsichtlich der Anzahl von Uterusnarben bei weiblichen Waschbären – ein wichtiger Indikator für die Fruchtbarkeit – keine Unterschiede zwischen bejagten und unbejagten Gebiet gibt.
Wie bei allen Säugetierarten bewegt sich die Geburtenrate des Waschbären innerhalb einer genetisch vorgegebenen Bandbreite. Einmal im Jahr, meist im April oder Mai, werden durchschnittlich 3 Jungtiere geboren. Die Fruchtbarkeit eines Waschbärweibchens, der Fähe, wird vom Ernährungs- und Gesundheitszustand sowie vom Alter beeinflusst. Fähen im ersten und zweiten Lebensjahr beteiligen sich zu 63 % an der Reproduktion, im optimalen Alter von drei und vier Jahren sind es rund 95 % und bei Individuen über fünf Jahren immerhin noch 90 %. In der vom Menschen geprägten Kulturlandschaft finden Waschbären reichlich Nahrung, sodass insbesondere in urbanen Räumen die Reviere der Waschbären vergleichsweise klein und damit die Siedlungsdichten sehr hoch sein können. Nahrungsmangel ist also kein limitierender Faktor, vielmehr führen Krankheiten wie Staupe, Straßenverkehr und Jagd zu Verlusten.
Ausgewählte Quellen:
Volmer, K. & Müller, F. (2020): Reproduktionsmedizinische Untersuchungen an weiblichen Waschbären aus Hessen. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, Bd. 45: 215-224: https://wildbeimwild.com/wp-content/uploads/2023/08/Volmer-Mueller-Repromedizinische-Untersuchungen-Waschbaer-BJWF-2020.pdf
Robel RJ, Barnes NA, Fox LB (1990): Raccoon Populations: Does Human Disturbance Increase Mortality? Transactions of the Kansas Academy of Science, 93(1/2), 22–27. https://doi.org/10.2307/3628125
Ist es nicht besser Waschbären zu kastrieren statt sie zu jagen?
Die Idee einer flächendeckenden Kastration von Waschbären wird immer wieder als vermeintlich tierschutzkonforme Maßnahme ins Spiel gebracht. Es existieren in Deutschland allerdings weder wissenschaftliche Veröffentlichungen noch Machbarkeitsstudien, bei denen freilebende Waschbären kastriert, wieder ausgewildert und ihr Verhalten wissenschaftlich begleitet wurden.
Nach Artikel 7 der EU-Verordnung Nr. 1143/2014 sowie § 40a Bundesnaturschutzgesetz ist die Freisetzung invasiver Arten nach dem Fang zudem ausdrücklich verboten, was eine Kastration mit anschließender Auswilderung ohne aufwändige Sondergenehmigungen rechtlich ausschließt. Hinzu kommt, dass kastrierte Waschbären weiterhin Beutetiere wie Boden- und Höhlenbrüter fressen können.
Als Wildtiere unterliegen Waschbären dem Tierschutzgesetz und dem Tierversuchsrecht, das bei Eingriffen wie Narkose, chirurgischer Kastration, postoperativer Versorgung und anschließender Freilassung hohe Anforderungen stellt. Die Genehmigung solcher Maßnahmen erfordert – je nach Bundesland – aufwendige tierschutzrechtliche Prüfverfahren, eine umfangreiche Logistik sowie erhebliche personelle Ressourcen.
Bei den rund 240.000 Waschbären, die in der Saison 2023/24 erlegt wurden, wäre eine Kastration weder personell noch finanziell realistisch. Abgesehen davon würde die Kastration von Waschbären nicht das Artenschutzproblem lösen, denn auch kastrierte Waschbären müssen fressen. Neben Arten wie Fuchs und Steinmarder ist der Waschbär ein zusätzlicher Räuber, der den Druck auf gefährdete Arten erhöht. Die Jagd ist deshalb eine effektive Managementmaßnahme für den Waschbären und muss von der Politik gefördert werden. Denkbar ist die Finanzierung von tierschutzgerechten Fanggeräten und Fallenmeldern.
Ausgewählte Quellen:
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143
Waschbären sind doch inzwischen eine heimische Art. Warum werden sie immer noch als gebietsfremd bezeichnet und intensiv bejagt?
Das ursprünglich Siedlungsgebiet des Waschbären reicht vom Süden Kanadas bis in den Norden Mittelamerikas. Da Waschbären hochwertige Pelze liefern und dies insbesondere in den 1930er Jahren Mode war, wurden Waschbären in Deutschland in Gehegen gezüchtet. Durch Kriegseinwirkungen gelangten Waschbären ins Freiland und konnten sich aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit ansiedeln, Populationen bilden und sich neue Siedlungsareale erschließen. Eine bewusste Ansiedlung eines Pärchens am Edersee in Hessen 1934 begründete den ersten freilebenden Bestand.
Arten, die absichtlich oder unbewusst von anderen Kontinenten nach Europa verfrachtet werden oder wurden, gelten als gebietsfremd. Der Waschbär ist eine gebietsfremde Art, die sich etabliert hat. Da gebietsfremde Arten sich nicht mit den heimischen Ökosystemen entwickelt haben, können sie im Falle ihrer Etablierung heimische Arten schädigen und gelten dann als invasiv. Beispielsweise vernichtet die aus Südamerika stammende Nutria Gewässerökosysteme, indem sie ganze Schwimmblatt- und Uferzonen kahlfrisst. Damit verändert sich die Strömungsgeschwindigkeit von Wasserläufen und wichtige Brut- und Lebensräume für Fische, Insekten und Vögel verschwinden.
Neozoen (gebietsfremde Tierarten) wie Mink und Waschbär treten als zusätzliche Fressfeinde auf. Der Waschbär ist auf der Unionsliste der gebietsfremden invasiven Arten. Damit gilt für ihn die EU-Verordnung Nr. 1143/2014 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141. Im Bundesnaturschutzgesetz § 40 a in Verbindung mit dem Maßnahmen- und Managementblatt ist der Umgang geregelt. Dies ist als Rahmenplan zu verstehen, wobei die Länder entscheiden können, welche Maßnahmen sie wählen und auf welche Maßnahmen sie den Schwerpunkt setzen. Die Jagd ist ein wichtiges Instrument im Katalog der Managementmaßnahmen. Die möglichst intensive Bejagung mit Waffe und Fallen dient der Eindämmung dieser invasiven Art und damit dem Erhalt heimischer Arten. Deshalb fordert der DJV ein klares Bekenntnis der Politik zur Jagd, insbesondere zur Fangjagd. Jagdzeitenbeschränkungen, die über den Elterntierschutz (§22 Bundesjagdgesetz) hinausgehen, lehnt der DJV ab. Dazu gehören beispielsweise Schonzeiten.
Ausgewählte Quellen:
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj
Nehring, S. (2018): Warum der gebietsfremde Waschbär naturschutzfachlich eine invasive Art ist - trotz oder gerade wegen aktueller Forschungsergebnisse. Natur und Landschaft 93: 453-461: https://shop.kohlhammer.de/warum-der-gebietsfremde-waschbar-naturschutzfachlich-eine-invasive-art-ist-trotz-oder-gerade-wegen-aktueller-forschungsergebnisse-978-3-00-153629-7.html
Maßnahmen- und Managementblätter: https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-19-management.html
Unionsliste: https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html
Bei Waschbären kontrollieren ältere Weibchen die Fortpflanzung in einer hierarchisch geführten Gruppe. Werden ältere Tiere erlegt, kommt es zu einer stärkeren Vermehrung jüngerer Tiere. Warum werden Waschbären trotzdem bejagt?
Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass Waschbären in streng hierarchischen, von älteren Weibchen geführten Gruppen leben. Es gibt weiterhin keine Belege dafür, dass die Entnahme älterer Weibchen zu vermehrter oder verfrühter Reproduktion jüngerer Tiere führt.
Tatsächlich zeigen verhaltensökologische Studien: Weibliche Waschbären leben nicht in festen Sozialverbänden, sondern in losen, dynamischen Gruppen, die sich vor allem zur Nahrungssuche temporär zusammenschließen. Dieses soziale System wird in der Wissenschaft als Fission-Fusion-Struktur bezeichnet – es ist geprägt durch wechselnde Gruppenzusammensetzungen ohne stabile Hierarchie. Ein dominantes Leittier oder eine „matriarchale Struktur“ existieren nicht. Die Fortpflanzung weiblicher Tiere erfolgt individuell, nicht sozial gesteuert. Manche Weibchen pflanzen sich bereits im ersten Lebensjahr fort, andere erst im zweiten. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass die Entnahme älterer Weibchen zu vermehrter oder verfrühter Reproduktion jüngerer Tiere führt.
Ausgewählte Quellen:
Prange S, Gehrt SD, Hauver S (2011): Frequency and duration of contacts between free-ranging raccoons: uncovering a hidden social system. Journal of Mammalogy, 92(6), 1331–1342. https://doi.org/10.1644/10-MAMM-A-416.1
Schuttler SG, Ruiz-López MJ et al. (2015): The interplay between clumped resources, social aggregation, and genetic relatedness in the raccoon. Mammalian Biology – Mammalian Research, 60, 365–373. https://doi.org/10.1007/s13364-015-0231-3
Menschengemachter Lebensraumverlust und Klimawandel sind die Ursachen für den Rückgang bedrohter Arten. Wieso wird nicht der Fokus auf die Lebensraumverbesserung gelegt und stattdessen die Jagd auf Waschbären eingestellt?
Weltweit sind neben Lebensraumzerstörung und Klimawandel auch gebietsfremde invasive Arten maßgebliche Faktoren für den Rückgang zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Genau deshalb ist es entscheidend, die zusätzliche ökologische Bedrohung durch invasive, gebietsfremde Arten wie den Waschbär zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zum Erhalt der Artenvielfalt hat sich Deutschland international verpflichtet. Neben Lebensraumverbesserung ist das Zurückdrängen invasiver Arten mit effektiven Maßnahmen eine wichtige Stellschraube.
Der Waschbär wirkt nachweislich negativ auf bereits geschwächte Populationen naturschutzrelevanter Arten, zum Beispiel von Amphibien. In sensiblen Lebensräumen kann er sogar das lokale Verschwinden bestimmter Arten verursachen. Einmal verschwundene Arten kehren in der Regel nicht zurück.
Menschen empfinden bestimmte Tierarten wie den Waschbären als besonders sympathisch oder niedlich. Diese positive Wahrnehmung führt dazu, dass notwendige Maßnahmen zur Kontrolle dieser Tiere schwieriger durchzusetzen sind oder nicht umgesetzt werden. Im Sinne des Artenschutzes ist hier ein Umdenken und die Anerkennung wissenschaftlich belegter Fakten notwendig, damit die Jagd auf den Waschbären als effektive Managementmaßnahme anerkannt, angewendet und unterstützt wird.
Ausgewählte Quellen:
Jarić I, Courchamp F, Correia RA, Crowley SL, Essl F, Fischer A, González-Moreno P, Kalinkat G, et al. (2020): The role of species charisma in biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(6), 345–353. https://doi.org/10.1002/fee.2195
IPBES Bericht zu invasiven gebietsfremden Arten (2023): https://www.de-ipbes.de/de/Neuer-IPBES-Bericht-zu-invasiven-gebietsfremden-Arten-veroffentlicht-2214.html
Download